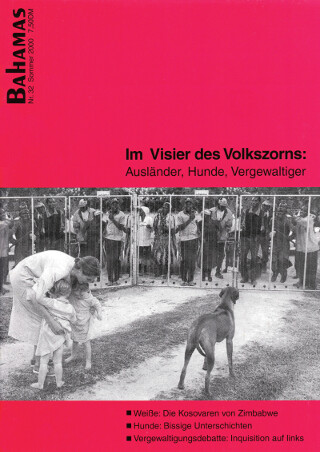Heißt Brecht jetzt Goebbels?
In neuen deutschen Frauenbiografien gibt es nur Opfer
Ein großes Anliegen der Frauenbewegung, das sich in den siebziger Jahren herauskristallisiert hat, war die Aufarbeitung weiblicher Geschichte. Dabei ging es zunächst besonders darum, eigenständige schöpferische Frauen – also Künstlerinnen und ihre Werke – in den Vordergrund zu stellen .
Während die ersten bewunderten und in Biografien beschriebenen Frauen (von Frida Kahlo bis zu Virginia Woolf) noch im weitesten Sinne dem linken Spektrum zuzuordnen waren und tatsächlich beträchtliche Leistungen auf ihrem Gebiet vorzuweisen haben, greifen in den letzten Jahren diese Kriterien kaum mehr. Immer schon ist in der Biografie angelegt, mehr von den persönlichen Verstrickungen des „großen“ Menschen zu erzählen, als seinem Werk die Autonomie zuzugestehen, die Kunstwerken jenseits aller historischen und persönlichen Entstehungsbedingungen eben eignet. Die Faszination für den Leser liegt häufig allein in der Identifikation mit dem Helden. Ob der Held schließlich etwas „Bleibendes“ hinterlassen oder getan hat, oder ob von geborgter Größe als Hoffotograf, Leibkoch oder eben Gattin bzw. Geliebte eines berühmten oder berüchtigten Menschen sein Existenzrecht zwischen Buchdeckeln abgeleitet wird, spielt für den Konsumenten von Biografien häufig keine entscheidende Rolle.
Bertolt Brecht – ein polygamer Ausbeuter
Der Frauenbiografieboom konzentriert sich zunehmend auf Frauen, die in Verbindung zu einem berühmten Mann stehen, und so verwundert es nicht allzu sehr, daß es mittlerweile keine Frau aus dem Umfeld von Bertolt Brecht mehr geben dürfte, die noch nicht mit einer eigenen Biografie gewürdigt worden wäre. Nun ist hervorzuheben, daß Sabine Kebir, die Biografin von Elisabeth Hauptmann (1) und ganz aktuell von Helene Weigel (2) sich vehement gegen den Trend zur Wehr setzt, Frauen – scheinbar willenlos – als Opfer privater Unterdrückungsverhältnisse, also eines konkreten Mannes, darzustellen. Aber auch Sabine Kebir schwimmt auf einer Welle mit, die ein ganz bestimmtes Frauenbild zementiert: Die Frau wird wahrgenommen in der Beziehung zu einem Mann, also als Liebende, während sein Terrain weiterhin das der Arbeit und der Politik ist. Die frauenbewegte Biografin solidarisiert sich zudem zunehmend mit ihrem Objekt, da wo es gelitten hat, und bewundert es als Bewältigerin widriger Lebensumstände. Da die Autorinnen solcher Bücher immer seltener Linke sind, die sich fragen, welches Ziel sie mit ihrer Arbeit verfolgen wollen, sondern in der Regel arbeitslose Geisteswissenschaftlerinnen, denen kritische Analyse einfach nicht geläufig ist, verwechseln sie immer öfter gesellschaftliche Machtverhältnisse mit privaten. So bewundert beispielsweise auch Ursula El-Akramy in Transit Moskau, einer ineinander verschränkten Biografie von Margarete Steffin und Maria Osten, an der Frau Steffin, wie tapfer sie sich durchs Leben schlägt, und empört sich über die sexuelle Untreue des Mannes Brecht. Damit suggeriert sie, das Problem Margarete Steffins wäre die Polygamie Brechts gewesen und nicht Nationalsozialismus, Vertreibung oder die Tuberkulose, die ihren proletarischen Wohnverhältnissen geschuldet war und an der sie starb. Damit suggeriert sie auch, daß Frauen aus einer sexuellen Beziehung das Recht auf lebenslange Fürsorge und Versorgung abzuleiten hätten.
So fungiert Ursula El-Akramy nicht nur als Wegbereiterin eines „neuen“ Puritanismus. Ihr „Feminismus“ beschränkt sich darauf, die Frau an sich entweder zur bewundernswert Starken hochzustilisieren, die ihren Weg geht, oder sie alternativ als Opfer privater Machtverhältnisse darzustellen. Damit liegt sie – von der gegenläufigen Argumentation Sabine Kebirs abgesehen – voll im Trend. Die Beschäftigung mit den Mitarbeiterinnen und Geliebten Brechts folgt scheinbar – allein durch die Wahl der beschriebenen Person – noch der linken feministischen Bemühung, Lebensberichte über kämpferische und künstlerisch begabte Frauen zu schreiben. Doch im Fall Brecht wird zunehmend der Argumentaion von John Fuegis dummer und denunziatorischer Biografie gefolgt, wonach der Dichter „seine“ Frauen rücksichtslos sexuell, künstlerisch und finanziell ausgebeutet habe. Jede große Gestalt der Geschichte ist immer Objekt schrankenloser Bewunderung und nagenden, kleinlichen Neids zugleich, und Standbilder zu stürzen gehört genauso zum bürgerlichen Zwangscharakter, wie das Aufrichten von Übermenschen. Dem Ausbeuter Brecht müssen daher mit Notwendigkeit seine Opfer vorgerechnet werden, Leute, die man sich so unscheinbar und unbedeutend vorstellt, wie man selber ist. Dafür werden sie geliebt. Von der eigenständigen Leistung und vom unabhängigen Charakter von Frauen wie Waigel, Steffin, Hauptmann oder Berlau darf bei einer solchen Abrechnung nichts übrig bleiben. Aber auch aus dem „großen Mann“ wird bei dieser Betrachtung nur das Gegenstück zum ausgebeuteten und gedemütigten weiblichen Opfer: der Täter. Und wo Täter ausgemacht werden verschwimmen links und rechts.
Ein zudringlicher Führer
Daß die als Opfer zurecht gemachte Frau gegebenenfalls für keine ihrer Entscheidungen oder Handlungen zur Verantwortung gezogen werden kann; daß man mit dieser ausschließlich frauenbewegten Herangehensweise und vor dem Hintergrund eines neuen „rechten Konsenses“ auch Frauen in den vorherrschenden Opferkanon einbauen kann, die man vor wenigen Jahren noch bekämpft hätte, bewies Alice Schwarzer mit ihrem Interviewporträt von Leni Riefenstahl, das Anfang 1999 erschien: „Wie alle Legenden ist auch die Riefenstahl aus der Nähe nur ein Mensch, in dem Fall noch ein weiblicher dazu, also bescheiden und verbindlich im Auftritt.“ So verschafft Schwarzer der Riefenstahl gleich zu Beginn den Sympathiebonus, mit dem Frauen mittlerweile rechnen können, so wie unsere Großmütter sich sicher sein konnten, daß jemand ihnen die Tür aufhält. Dann folgt die rühmende Aufzählung der Riefenstahlschen Kulturleistungen in einem durchaus den früheren Huldigungen linker Künstlerinnen und Kritikerinnen verwandten Stil (noch vor gut 10 Jahren hatte Schwarzer in kindischer Bewunderung Simone de Beauvoir mit ihren langweiligen Fragen bedrängt). Aber anders als bei Beauvoir, die sich den Sartre nie madig machen ließ, verwandelt sich in Schwarzers Riefenstahl-Text plötzlich die tolle Berufstätige in ein bloßes Opfer: „Und noch einer bewunderte sie über die Maßen, ohne dessen Admiration ihr viel Ärger erspart geblieben wäre: Adolf Hitler.“ So erscheint auch die Riefenstahl nur noch als passives Objekt männlicher Begierde für deren Folgen sie nach moderner Lesart wohl genausowenig verantwortlich gemacht werden kann wie Beauvoir für den Sartreschen Existentialismus in ihrem Werk.
Obwohl sie im weiteren Verlauf des Interviews zugibt, für „den Führer geschwärmt“ zu haben, allerdings „wie Millionen andere Deutsche auch“, bleibt Schwarzer entsetzt über das Unrecht, das dieser Frau angetan wurde: „Die Folgen dieser sträflichen Naivität“, schreibt sie und meint den Riefenstahlschen Propagandafilm über den NSDAP-Parteitag 1934, „wird auch sie persönlich teuer bezahlen. Riefenstahl wird den braunen Schatten nie mehr loswerden. 70 Jahre Arbeit, davon drei Monate im Dienste Hitlers – und sie gilt lebenslang als Nazikünstlerin.“ Schwarzer, die im Übrigen Riefenstahls Film über die Olympiade 1936 und ihre weiteren braunen Hervorbringungen unterschlägt, beklagt eine „Hexenjagd“, die bis heute andauere. Schließlich habe sich die Riefenstahl nicht mehr zu Schulden kommen lassen, als viele andere Deutsche auch. Naiv sei sie gewesen, ein weibliches Opfer eben, denn männlicher Bewunderung sich zu erwehren, das scheint in den Augen Schwarzers keine Fähigkeit zu sein, über die Frauen verfügen.
Die öffentliche Verschwesterung der populärsten Feministin der BRD mit Hitlers Regisseurin entspricht dem Trend. Sie wurde möglich vor dem Hintergrund des unreflektierten, weiblichen Biografiebooms.
Annäherungen an ein Opfer
Die Frauenbewegung und in Folge der Kulturbetrieb hat nun die deutsche Frau und ihre Leiden am Patriarchat entdeckt, insbesondere die zwischen 33 und 45 oder in den „schwierigen“ Jahren danach. Eva Braun wurde schon als Protagonistin auf Berliner Bühnen gezerrt, Emmy Göring wird es demnächst. Die deutsche Filmszene wurde bereichert und vor allem die Lesbenszene zu Tränen gerührt ob der Liebesgeschichte – vor der Folie des Nationalsozialismus – zwischen einer Jüdin und einer deutschen Hausfrau und Mutter, die, bevor ihr Coming-Out sie eines besseren belehrte, felsenfest davon überzeugt war, „Juden riechen zu können“. (3)
Plötzlich war es soweit: Nachdem die deutsche Bevölkerung es sich jahrzehntelang hatte gefallen lassen müssen, von den überlebenden Opfern an ihre Verbrechen erinnert zu werden, dürfen sich jetzt auch die ganz normalen Deutschen aussprechen, vorausgesetzt, sie sind auch ein bißchen Opfer. Und als Frau, die Botschaft ist inzwischen überall angekommen, ist man das irgendwie immer. Im Jahr des Riefenstahl-Interviews ging mit Ilse Schmidt eine ehemalige Wehrmachtsangehörige auf Lese-reise, die sich im Titel ihrer Autobiografie explizit als „Mitläuferin“ und keinesfalls als Täterin versteht. (4) Der Berliner Lokalverlag „Zwei Zwerge“ warf unlängst eine weibliche Autobiografie unter dem Titel „Bis zum Häkelgeschwader“ auf den Markt, in der die Autorin erzählen darf, wie schwer es war für deutsche Frauen, damals unter Hitler. Frauenbewegte Geisteswissenchaftlerinnen halten die deutsche Frau nun grundsätzlich für biografiewürdig: Magda Goebbels zum Beispiel. Letzte Schamgrenzen sind gefallen, und für den Bertelsmann Verlag ging die Journalistin Anja Klabunde unter dem Titel „Annäherung an ein Leben“ daran, Magda Goebbels in den weiblichen Opferkanon einzubauen. „Ich beschloß, ihren Spuren nachzugehen,“ schreibt sie einführend, „denn Magda Goebbels’ Leben schien mir in gewisser Weise die Tragik und Verblendung Deutschlands in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts widerzuspiegeln. Gleichzeitig erhob sich für mich die Frage: Wie konnte eine so intelligente und gebildete Frau einem solchen Fanatismus zum Opfer fallen?“ (5)
Der Eindruck, daß Klabunde sich der Goebbels emotional bis zur völligen Distanzlosigkeit angenähert hat – „verblendet“, „Tragik“, „intelligente und gebildete Frau“, „zum Opfer gefallen“ – täuscht nicht: Auf den nächsten dreihundert Seiten entwirft Klabunde das Bild einer schmerzgebeugten Frau mit psychosomatischen Beschwerden an der Seite eines ständig fremdgehenden Mannes.
Anja Klabunde sei da einer ganz großen Sache auf die Spur gekommen, heißt es bereits im Klappentext, denn Magda Goebbels hatte einen jüdischen Stiefvater und ihre erste Beziehung zu einem Mann war die zum jüdischen Intellektuellen Viktor Arlosoroff, der 1920 nach Palästina auswanderte. „Ihre Beziehung“, dröhnt der Bertelsmann Verlag „gehört bis heute zu den Tabus der israelischen Geschichte.“
Ein Tabu ist etwas, an das man nicht rührt, weil es zu schmerzlich oder peinlich wäre, daran erinnert zu werden. Inwiefern es ausgerechnet der israelischen Geschichte peinlich sein sollte, zur Kenntnis zu nehmen, mit welch entfesselter Kälte Deutsche auch ihnen einst Nahestehende verrieten, als es opportun erschien bzw. sich ihnen die Möglichkeit zum sozialen Aufstieg bot, wird nicht verraten, aber antisemitische Zuschreibungen bedürfen schließlich keiner Logik. Während der Verlag ein Tabu in Israel verortet, gibt Klabunde den Juden die Schuld an Magdas tragischer Entwicklung. Einfühlsam berichtet sie, was sie nicht wissen kann: „Als sie mit dem Taschentuch ein wenig an der Scheibe reibt, sieht sie den halbaufgetauten schmutzigen Schnee auf der schwärzlichen Straße liegen. Drinnen ist alles so vertraut wie immer, und doch fühlt sie sich auf einmal nicht mehr dazugehörig. Diese Welt mit ihrer Lebhaftigkeit und Wärme ist nicht wirklich die ihrige. Sie ist keine Jüdin, auch wenn alle liebenswürdig zu ihr sind, bleibt sie doch eine Außenseiterin, eine blonde ‚Schickse‘, wie die jüdischen jungen Männer die christlichen jungen Mädchen halb abfällig, halb sehnsüchtig nennen. Sie wird in diesem Kreis nur akzeptiert, weil sie Viktors Freundin ist.“ (6)
Für die, die immer noch nicht verstanden haben, wer die Schuld an der inneren Einsamkeit der jungen Frau trägt, erklärt Klabunde zum wiederholten Mal: „In dem katholischen belgischen Kloster blieb sie das deutsche Mädchen mit dem jüdischen Stiefvater; nach der Flucht aus Belgien war sie in dem protestantischen Lyzeum in Berlin ein ‚Flüchtlingskind‘, und ihr Deutsch hatte einen französischen Akzent; der zionistischen Jugendgruppe um Alosoroff blieb sie – trotz aller Anstrengungen dazuzugehören – doch die ‚blonde Schickse‘; und um für Quandt [ihren ersten Ehemann] gesellschaftsfähig zu werden, mußte sie sowohl den Namen ihres Stiefvaters ablegen als auch vom Katholizismus zum Protestantismus konvertieren. Auch in der Ehe mit Quandt fühlte sie sich nicht aufgehoben, sondern es war ihr nur sehr langsam gelungen, sich Stück für Stück etwas Anerkennung zu erkämpfen.“ (7)
Wer will es dieser unglücklichen Frau also verdenken, wenn sie – allein, um die Leere ihres Lebens zu bekämpfen, so Klabunde – in die NSDAP eintritt. Die Beziehung zu Goebbels hat selbstverständlich allein sexuellen, keinen politischen Charakter: „Seine Stimme, die Intensität, die er ausstrahlt, haben auf Magda eine fast erotisierende Wirkung und schlagen sie in ihren Bann. Ein Engagement für diese Partei verspricht auch ihr Erlösung von ihrer unwirklichen Existenz.“ (8)
Von nun an wird die Geschichte des Nationalsozialismus zur Eheklamotte umstilisiert. Empört weist Klabunde ihre Leserinnen auf die Untreue des Ehemannes hin, der sie auch in jeder anderen Beziehung unterdrückt. Magda resigniert: „Seine antisemitischen Hetzreden und seine Attacken gegen den ‚Bolschewismus‘ nimmt sie als gegeben hin.“ (9) Damit suggeriert Klabunde nicht nur, daß Antisemitismus und „Antibolschewismus“ nicht im eigentlichen Sinne der Goebbels lagen, sie geht noch einen Schritt weiter und unterstellt ihr einerseits gar widerständlerische Tendenzen. (10) Sie tut alles, um sie zu entschuldigen. 1938 sei der private Leidensdruck der Goebbels so groß geworden, daß allein der Nationalsozialismus sie noch auf den Füßen hielt, wie andere schwerkranke das Morphium. „Wenn sie allerdings die Ideologie des Nationalsozialismus auch noch in Frage stellen würde, wenn sie die Barbarei in ihrem Umfeld bewußt wahrnähme, verlöre sie wahrscheinlich den Boden unter den Füßen, dann stünden weder Hanke neben ihr noch Hitler hinter ihr.“ (11)
Wie Alice Schwarzer ein Ende der „Hexenjagd“ gegen Leni Riefenstahl einfordert, kommt auch Anja Klabunde zu dem Schluß, daß es sich bei Magda Goebbels um ein Opfer handelt, eine, die entsetzlich endete, die ein schreckliches Schicksal erlitten habe. Und das, so stellt sie im Nachwort fest, ist doch irgendwie ungerecht: „Emmy Göring beispielsweise überlebte das Kriegsende mit ihrer Tochter und wohnte unbehelligt in der Bundesrepublik. Man fragt sich: Warum mußte ausgerechnet Magda Goebbels so entsetzlich enden?“ (12)
Mutter ging voran und führte
Nun könnte man einwenden, Anja Klabunde sei eine Ausnahmeerscheinung und der Bertelsmann-Verlag keiner, dessen Produkte man prüfend zur Kenntnis nehmen müßte. Doch im Jahr der Magda Goebbels-Biografie, 1999, erschien bei Rowohlt etwas, von dem man nicht genau sagen kann, um was es sich eigentlich handelt. Unter dem Titel „Mutter mochte Himmler nie“, der fälschlicherweise eine gewisse Distanz von „Mutter“ zur NS-Spitze suggeriert, erzählt Ingeburg Schäfer unter Beihilfe von Susanne Klockmann „Die Geschichte einer SS-Familie“. Einfach mal so, frisch von der Leber weg. Wahrscheinlich hat Frau Schäfer einen – wenn auch sehr begrenzten – kritischen Blick auf ihre Eltern, und es ist nicht ihre Schuld, daß der Verlag es nicht für nötig hielt, den auch einzufordern. Im Buch plaudert sie freundlich und distanzlos über den SS-Mann Schäfer, Polizeipräsident von Lodz (und als solcher verantwortlich für die Einrichtung und Abriegelung des Ghettos) und seiner Frau (seit 1929 NSDAP-Mitglied). So wird den beiden der Platz eingeräumt, von dem Ingeburg Schäfer offensichtlich überzeugt ist, daß er ihnen zusteht.
1938 wurde Schäfer Führer des 26. SS-Abschnitts in Danzig und Ingeburg plaudert munter drauflos: „Als wir nach Danzig kamen, war ich noch nicht ganz fünf Jahre alt. Wir blieben dort bis 1943, und ich habe eine Reihe schöner Erinnerungen an diese Zeit. Wir wohnten am Stadtrand in einem Zweifamilienhaus in der Lindenstraße, die von der Allee nach Oliva und Zoppot abgeht und im Wald endet. In dieser Gegend gab es viele Parks, Sportplätze und Krankenhäuser. Zu unserem Haus gehörte eine Gartenlaube, in der wir nachmittags Kaffee trinken und mit Kindern aus der Nachbarschaft spielen konnten.“ (13) So plauscht sich Schäfer durch die NS-Geschichte und die Besatzung Polens, die ihr als Kind ganz prächtig gefallen hat, und bewundert ihre Mutter noch im Nachhinein für das, was sie alles leisten mußte: „Als wir nach Danzig kamen, war Mutter eine junge Frau von sechsundzwanzig Jahren. Heute studieren viele Frauen in diesem Alter noch; Mutter hatte bereits zwei Kinder und erwartete das dritte. Vaters Funktion verlangte von ihr, daß sie viel repräsentierte und sie wuchs in ihre Aufgaben hinein. Diese Dinge habe ich als Kind natürlich nicht mitbekommen, aber ich versuche mir manchmal vorzustellen, wie Mutters Leben damals gewesen ist. Sie war die Gattin eines hohen SS-Offiziers in einem Kleinstaat, der gerade in diesen Jahren die Blicke der Welt auf sich zog und dessen führende Schicht von den Blitzlichtern der Presse begleitet wurde.“ (14)
„Mutter“ war überhaupt eine klasse Frau: Wenn sie einen Kutscher sah, der sein Pferd schlug, ging sie dazwischen. Nur heute fragt sich Ingeburg Schäfer manchmal, „ob sie mit den Juden, denen im Dritten Reich so viel Entsetzliches widerfuhr, ebensoviel Mitleid hatte, wie mit mißhandelten Pferden.“ (15) Außer Ingeburg Schäfer stellt sich diese Frage sicher niemand, denn sie ist angesichts des Lebenslaufs von Eva Schäfer, die bis zu ihrem Tod 1985 überzeugte Nationalsozialistin blieb, eindeutig mit Nein zu beantworten. Aber Frauen dürfen, außer lebenslang über das Offensichtliche nachzugrübeln, auch sonst ziemlich viel. Ingeburg Schäfer: „Rassenkunde liebte Mutter noch nach dem Krieg. Sie betrieb das wie ein Gesellschaftsspiel, bei dem wir gern mitmachten.“ (16) Sie führt die Regel des „Gesellschaftsspiels“ en detail aus, um dann zu dem Schluß zu kommen, daß ihre Mutter – trotz ihrer nationalsozialistischen Überzeugungen – keine Rassistin gewesen wäre: „Das war typisch für sie: im konkreten Umgang spielten ihre rassischen Überzeugungen keine Rolle.“ (17)
Mittlerweile ist auch schon die „Katastrophe“ über die Schäfers hereingebrochen: Wir schreiben das Jahr 1944 und Ingeburg bewundert Mutter im Nachhinein um so mehr: „Nie jammern, nie den Kopf hängenlassen. Und: immer durchhalten. Weihnachten 1944 war die Lage bereits katastrophal.“ (18) Natürlich bewährt sich Mutter auch auf der Flucht und in der schwierigen Zeit, als Vater, der als Kriegsverbrecher gesucht wird und versteckt werden muß: „Mutter mußte wieder rennen, fragen, bitten, suchen – und fand schließlich zwei Räume in einer Baracke voller Flüchtlinge und Evakuierter. Einige Zeit stieß auch Vater zu uns, doch unseren Eltern blieb nicht viel Zeit zum Ausruhen. Sie besaßen nicht einmal genügend Geld, um die Miete auch über den Winter bezahlen zu können.“ (19)
Spätestens jetzt hat man den Eindruck, als wären die obersten SS-Chargen die Leidtragenden des NS-Regimes gewesen, und bevor Ingeburg Schäfer erwähnt, daß sie ihre alten gebeutelten Eltern bei sich aufgenommen hat – schließt sie mit einem Fazit im NS-Sprachstil, das eine Hommage an ihre Mutter ist: „Mutter ging voran und führte, sie meisterte unser Leben, sie hatte immer gute Laune und machte allen Mut, während Vater sich nicht in erster Linie als Teil unserer bedrängten Familiengemeinschaft verstand, sondern als leidendes Individuum.“ (20)
Das ist der Dreh, der den Verlag überzeugt haben muß, denn die frauenbewegte Leserinnenschaft liest gerne von Frauen, die, zwar leidend und vom Manne betrogen, bei der Verteilung der Kleidermarken, den Kopf dennoch immer oben behalten und sich und die Ihren durch stürmische Zeiten bugsieren. Für solche Resultate hat die Frauenbewegung – nicht mehr diskutierend, nicht mehr fragend: Zu welcher Konsequenz führt mich meine Argumentation, ist sie durchdacht? – das Terrain mit bereitet.
Birgit Schmidt (Bahamas 32 / 2000)
Anmerkungen:
- Vgl. Sabine Kebirs Biografie über Elisabeth Hauptmann: „Ich fragte nicht nach meinem Anteil“
- Sabine Kebir: „Abstieg in den Ruhm“
- „Gegen Ende Oktober kommt Inge aufgebracht von der Arbeit heim. ‚Mensch, jetzt bin ich doch wieder bei so was gelandet! [bei einer Nationalsozialistin] Weißt du, was sie mir heute gesagt hat? ,Juden, Die riech ich ja!‘ ‚Auja? Was hat sie gesagt, sie riecht Juden? Das möchte ich ausprobieren?’“
- Erica Fischer: „Aimée & Jaguar. Eine Liebesgeschichte Berlin 1943“, 1994, S. 118. Felice Schragenheim lernte Lilly Wust kurz nach diesem Gespräch kennen, durch daß sie sich provoziert fühlte, die Probe aufs Exempel zu machen.
- Ilse Schmidt: „Die Mitläuferin. Erinnerungen einer Wehrmachtsangehörigen“, 1999
- Anja Klabunde: „Magda Goebbels. Annäherung an ein Leben“, 1999, S. 9
- ebda. S. 44
- ebda. S. 112
- ebda. S. 114
- ebda. S. 231
- „Obwohl sie (Ello Quandt) zum nationalsozialistisch beeinflußten Umfeld Magdas gehörte, wagte Magda in ihrer Gegenwart sogar Kritik am NS-Regime.“ Man muß sich das auf der Zunge zergehen lassen: „nationalsozialistisch beeinflußt“, wenn von der Spitze des NS-Regimes die Rede ist.
- ebda. S. 245
- ebda. S. 296
- Ingeburg Schäfer/Susanne Klockmann: „Mutter mochte Himmler nie. Die Geschichte einer SS-Familie“, 1999, S. 49
- ebda. S. 52f
- ebda. S. 57
- ebda. S. 118
- ebda. S. 119
- ebda. S. 128
- ebda. S. 165
- ebda. S. 180f
SPALTE3-AKTUELL-RUBRIK
Frühere Aktivitäten sind im Aktuell-Archiv aufgeführt. Dort gibt es auch einige Audio-Aufnahmen.
Alle bisher erschienenen Ausgaben der Bahamas finden Sie im Heft-Archiv jeweils mit Inhaltsverzeichnis, Editorial und drei online lesbaren Artikeln.