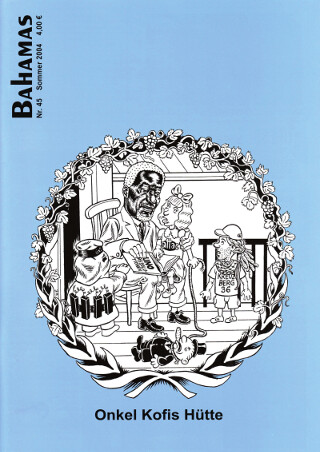Arabische „Herrenmenschen“ machen im Sudan mobil
Jean Ziegler, Schweizer Soziologieprofessor und verdientes Mitglied der Schweizer Sozialdemokratischen Partei, mag weder den globalen Kapitalismus noch die USA noch die sogenannte westliche Welt überhaupt: Das wurde schon 2001 deutlich, als er eine mediale Kampagne initiierte, die sich gegen den Feldzug der USA gegen das Afghanistan der Taliban richtete, in deren Mittelpunkt die wahnwitzige Behauptung stand, USA wie Alliierte untersagten das Abwerfen von Nahrungsmitteln im Kriegsgebiet und forcierten so wissentlich eine „humanitäre Katastrophe“ unter der afghanischen Zivilbevölkerung. Wie so viele Feinde der westlichen Zivilisation mag Ziegler auch Israel nicht besonders: Denn Israel, so Ziegler in einem Bericht zur Ernährungslage in Gazastreifen und Westbank aus dem Jahr 2003, übe schließlich auch gegen die zivilen Palästinenser gezielten „Staatsterror“ aus, begehe unentwegt und ungestraft „Kriegsverbrechen“ und „gehe“ überhaupt „ganz ähnlich wie Nazi-Deutschland vor“(1). Was genau Herrn Ziegler, dessen Aufgabe als UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung doch eigentlich bloß darin bestünde, die Ernährungslage der Menschen in Westbank, Gazastreifen und anderswo zu untersuchen und zu beurteilen, dazu bewogen haben mag, sich die Unterernährung breiter Teile der palästinensischen Bevölkerung schlicht auszudenken, um sie wie so vieles andere dem jüdischen Staat anlasten zu können und so einen Vorwand mehr zur Hand zu haben, um zum Boykott israelischer Waren weltweit aufzurufen – man kann es nur vermuten. Mitgefühl mit den an Hunger Leidenden und die Wut gegen solche, die dergleichen zulassen oder gar intendieren, kann es nicht gewesen sein, denn bezeichnenderweise war die Kommission, die er in die Westbank und den Gazastreifen entsandte, um die dortigen Verhältnisse zu untersuchen, die einzige, die er überhaupt im Jahr 2003 auf die Reise schickte – tatsächliche Hungersnöte wie die in Burundi, Liberia, Sierra Leone und anderswo scheinen ihn wenig zu interessieren, auch Gegenden, in denen der Hunger von Seiten der Regierung gezielt als Waffe gegen unliebsame Bevölkerungsteile eingesetzt wird, wie etwa im Sudan, vermögen die Aufmerksamkeit Zieglers nicht zu erregen: Obwohl im Sudan seit Jahrzehnten und seit ca. 18 Monaten insbesondere in Darfur Menschen gezielt aus ihren Dörfern vertrieben und so von ihren Nahrungsquellen abgeschnitten werden, und Menschenrechtsorganisationen davor warnen, daß mit etlichen von Hungertoten und solchen durch Krankheit zu rechnen sei, entsandte er bis dato nicht einen Delegierten dorthin. Zwar geht Ziegler nicht so weit wie der Botschafter des Sudan in der EU, der Berichten über eine humanitäre Krise in Darfur trotzig entgegnete: „Dort gibt es keine Hungersnot“ (Tagesspiegel, 28.07.04) – die Beteiligung der sudanesischen Regierung an den Zuständen im Westen des Landes unterschlägt aber auch er: Kein Wort ist in seinem Bericht zum Sudan darüber zu lesen, daß dessen Regierung die Nahrungsmittel- und Wasserknappheit der Gegend erst forcierte und daß im Kampf gegen mutmaßliche schwarzafrikanische Rebellen von Seiten der Regierung das Aushungern seit Jahrzehnten als Waffe gegen die Bevölkerung ebenso eingesetzt und geduldet wird wie auch Vertreibung, Brandschatzung, Vergewaltigung und der gezielte Mord Zehntausender. Kein Wort ist von Ziegler auch dazu zu hören, daß internationalen Hilfsorganisationen der Zugang zu den von Hunger bedrohten Gebieten verweigert wird.
Kein Friede mit Israel
Aber bei den Tätern in Khartoum und Darfur handelt es sich ja auch nicht um Juden, sondern um Araber, die wie ihre Brüder und Schwestern in Palästina, so der im Exil lebende sudanesiche Schriftsteller Tajjib Salich, stellvertretend für so viele Anhänger der panarabischen Solidarität, doch nicht nur eine – wie die Juden Europas – sondern gleich „zwei traumatische Erfahrungen hatten, (...) die Kolonisation (...) [und] die Schaffung von Israel in Palästina“ (Freitag, 19.04.02). So lange Israel noch existiere, könne das Trauma nicht überwunden werden, so lange Israel als Pfahl im Fleische des arabischen Volkskörpers stecke, werde kein Frieden einkehren im Nahen Osten – weder in der Westbank, in Jerusalem noch im Sudan, so die implizit mitschwingende These. Das eigentliche Problem in der Region sei Israel – und dies, so die Irrenlogik, beweise der Sudan nur einmal mehr: Denn schließlich wurden und werden auch die Rebellen im Südsudan, gegen welche die arabische Regierung in Khartoum seit Jahrzehnten zu Felde zieht, logistisch von Israel unterstützt.
Mit seiner manischen Fixierung auf die vermeintlichen Greueltaten der Israelis befindet sich Jean Ziegler innerhalb der UNO in bester Gesellschaft: Immerhin sechs der überhaupt nur zehn einberufenen „Emergency Special Sessions“ der UNO waren allein der Causa Israel gewidmet, von denen die letzte schon seit 1997 „ausschließlich über das besetzte Ostjerusalem und die anderen besetzten palästinensischen Gebiete’“ (SZ, 20.07.04) handelt und von der aus die Aufforderung an den Internationalen Gerichtshof erging, doch abschließend die Rechtmäßigkeit der israelischen – wie es in linken Kreisen so schön heißt – „Apartheidsmauer“ zu prüfen. Die 15 Richter des Gerichts entschieden denn auch ganz im Sinne der UNO, die gewöhnlich – mit Ausnahme der USA und der Marshall-Inseln – eine jede „israelische Antwort auf den Terror als illegal verurteil[t]“ (WamS, 27.06.04), und bezeichneten am 9. Juli dieses Jahres erwartungsgemäß den Bau des Sicherheitszaunes als unrechtmäßig – die europäische wie die arabische Öffentlichkeit applaudierten und immer deutlicher zu vernehmen ist seither die Forderung, mit diesen „Nazis des 21. Jahrhunderts“ umzuspringen wie mit denen des 20. Fast 30% der Berichte und Resolutionen der UN-Menschenrechtskommision, in der die Länder des „arabisch-islamisch-afrikanischen Blocks“ eine „automatische Mehrheit“ (SZ, 20.07.04) bilden, haben die Verurteilung israelischer Taten oder Vorhaben zum Inhalt – die letzte wurde im April dieses Jahres verabschiedet und verurteilt ganz allgemein „das israelische Umgehen mit den Palästinensern“ sowie die israelische „Besetzung der Golanhöhen“ (ebenda). Eine weitere erkleckliche Prozentzahl der Resolutionen und Berichte richtet sich zudem gegen die „Diffamierung des Islam und Diskriminierung der Moslems und Araber“ (WamS, 27.06.04) durch Israel und die USA – keine einzige hingegen etwa gegen den Libanon, wo die dorthin geflüchteten Palästinenser immer noch in Lagern gehalten werden und keinerlei Bürgerrechte genießen. Eingebracht werden entsprechende Berichte und Resolutionsentwürfe gewöhnlich von Abgeordneten der arabischen Staaten, verabschiedet werden sie mit der stillschweigenden Zustimmung der europäischen Staaten. Analog zur UN-Menschenrechtskommission, in die Israel im übrigen schon seit 1970 nicht mehr gewählt wurde und der auch die USA zumindest im Jahre 2002 nicht angehörten, verhalten sich gewöhnlich die regierungsunabhängigen Menschenrechtsgruppen: „Sie stürmten durch Djenin, um – gefälschten – Berichten über Juden, die Araber massakrieren, nachzugehen“ und schwiegen, als während des „Schwarzen Septembers“ im Jahre 1970 „tausende Palästinenser von Jordanien umgebracht wurden“ (Boston Globe, 05.10.02).
Ein jeder Araber gilt als potentiell von Israel Vertriebener und daher als eigentliches Opfer der Geschichte, dem man daher einiges nachzusehen habe. Werden aber von sogenannten Arabern Verbrechen begangen, bei denen man auch beim schlechtesten Willen keine Beteiligung israelischer oder US-amerikanischer Geheimdienste und Truppen aufspüren kann wie derzeit im Westsudan, dann ist es in der UNO mit allem humanitären Pathos und allem Aktionismus sehr schnell vorbei: Von der Menschenrechtskommission wird zu den Zuständen in Darfur, den dortigen Lagern sowie denen in Tschad, die von einer Delegation, gemeinsam mit Vertretern Khartoums besucht wurden, nur ein mickriger Bericht von gerade mal 23 Seiten vorgelegt und im Sicherheitsrat ringt man sich erst nach wochenlanger Diskussion zur Verabschiedung einer Resolution durch, welche die Regierung des Sudan zum Stopp der von ihr unterstützten Vorgänge in Darfur und zur Bestrafung der Täter veranlassen soll, als Druckmittel allerdings keinerlei Sanktionen in Aussicht stellt.
Homegenität durch Zwangsarabisierung
Doch was weiß man eigentlich über das, was im Sudan geschieht? Schön zugegangen, so nimmt man an, sei es da noch nie. Beherrscht wird das Land seit Jahrhunderten von arabisierten Eliten, die im Nordsudan und dort insbesondere in der Hauptstadt Khartoum ansässig sind. Im 19. Jahrhundert träumte man dort, als man noch Teil des zerfallenden osmanischen Reiches war, von der Errichtung eines modernen allislamischen Bundes, eine Idee, die man, angeregt durch die Lehren Wahabs und seines sudanesischen Pendants Muhammad Ahmed, des „von Gott geleiteten“ Mahdi, der sein Konzept eines reformierten modernen Islam auf blutigste Weise im Land verbreitete, gegen Ende des Jahrhunderts zugunsten der panarabischen Idee aufgab. Die Herrschaft Allahs zumindest auf sudanesischem Territorium zu errichten, war seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahre 1956 denn auch erklärtes Ziel der Khartoumer Eliten. Die nichtislamischen Schwarzafrikaner im Süden des Landes widersetzten sich jedoch einer jeden Missionierungskampagne und hatten auch nicht vergessen, daß ihre Vorfahren von eben diesen Herrscherbanden noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts auf den Sklavenmärkten Nordafrikas feilgeboten wurden. Seit der Unabhängigkeit des Sudan herrscht dort zwischen rebellierenden schwarzafrikanischen Christen und Animisten und den wechselnden Despotien im Norden des Landes und ihren mehr oder weniger offiziellen Truppen Bürgerkrieg. Im Februar letzten Jahres brach denn auch in der Region Darfur im Westen des Sudan offener Krieg aus. Übergriffe der sich selbst der arabischen Minderheit in Darfur zurechnenden Djandjawid („unsterbliche Ritter“ (FAZ, 28.07.04) oder auch „Reiter mit Gewehren“ (Le Monde Diplomatique, Mai 2004)) auf von Schwarzafrikanern bewohnte Dörfer sind dort zwar schon seit Anfang der 90er Jahre bekannt, als sich aus dem Tschad geflüchtete arabische Nomaden mit denen in Darfur verbündeten und im Kampf um die spärlichen Wasserreserven dieser Region die Bauern aus ihren Dörfern zu vertreiben begannen. Verschärft hat sich der Konflikt in Darfur aber erst, nachdem sich am 25. Februar 2003 die 2000 gegründete Darfur Liberation Army (DLF), die sich im März desselben Jahres in Sudan Liberation Movement/Sudan Liberation Army (SLM/A) umbenannte, gemeinsam mit dem Justice and Equality Movement (JEM) zum bewaffneten Widerstand gegen die Übergriffe der Djandjawid entschloß. Seitdem ziehen bewaffnete arabische Banden marodierend durch die Dörfer, brandschatzen und töten, was ihnen in den Weg kommt – die Bilanz: geschätzte „120.000 Gewaltopfer“, zu denen „nochmals rund 60.000 Tote hinzu(kommen)“, die an „Krankheiten und Unterernähung zugrunde(gehen)“ werden (NZZ, 24./25.07.04), und über eine Million Menschen, die aufgrund der Übergriffe der Djandjawid ihre Dörfer verlassen haben, und seitdem mehrheitlich in der Region herumirren oder sich in Lager an der Grenze zum bzw. im Tschad retten konnten.
Ähnlich der südsudanesischen Sudanes People’s Liberation Army (SPLA) um John Garang kämpfen die Rebellen in Dafur auch gegen die von der Regierung in Khartoum forcierte politische wie ökonomische Marginalisierung ihrer Region – im Süden und in der Region Darfur fehlt es an Strom, Wasser, Schulen und Straßen – und gegen die seit 1989 betriebene Zwangsarabisierung des ganzen Landes. Wie einst im Süden des Landes, wo die Mudschaheddin der paramilitärischen Popular Defense Force (PDF) jede Unterstützung der Regierung erhielten, die sie sich wünschen konnten, entschied die Regierung denn auch bezüglich Darfur: Nachdem die Rebellen erste militärische Erfolge für sich verbuchen konnten – so z.B. die Eroberung der zweitgrößten Stadt der Region, Melleit –, beschloß die Regierung in Khartoum, in das Geschehen einzugreifen: Zwar wird gegen die Rebellen in Darfur nicht – wie einst gegen die im Süden – mit, aus dem Irak gelieferten, Giftgas vorgegangen, aber auch hier fliegt die sudanesischen Luftwaffe regelmäßig Angriffe auf Dörfer, von denen vermutet wird, daß sie Rebellen Unterschlupf bieten und auch in Darfur werden die arabischen Milizen von der Regierung nicht nur mit modernsten Waffen versorgt, sondern auch mit ausgebildeten Truppen unterstützt. Die Djandjawid können daher „nicht (...) einfach nur als von der sudanesischen Regierung unterstützte Milizen bezeichnet werden. Sie arbeiten ganz gezielt mit den Regierungstruppen zusammmen und können zudem mit Straffreiheit für ihre massiven Verbrechen rechnen“, so Kenneth Roth. (zit. nach Jungle World 20/04)
Kein Krieg für Öl
Doch warum das Ganze? Nach landläufiger Meinung unterdrücken die arabischen Muslime im Nordsudan die nach Sezession strebenden Bevölkerungsgruppen im Osten, Westen und insbesondere Süden des Landes einzig, um einer „Balkanisierung“ des Sudan vorzubeugen. In Darfur votiert allerdings so gut wie niemand für Sezession und auch im Süden des Landes kämpfte die SPLM lange für die Reformierung des Staates hin zu einem ungeteilten säkularen Sudan. Die heute populäre Vorstellung von einem eigenen, unabhängigen Staat resultiert eher aus dem Mißtrauen gegen die Khartoumer Regierung, die sich bis dato nicht an eine der in verschiedenen Verträgen getroffenen Vereinbarungen hielt, denn aus ideologischen Prämissen. Daß der eigentliche Grund für die immer wieder auflodernden Konflikte im Süden und Westen des Landes allein darin zu sehen sei, daß, wie z.B. in Le Monde Diplomatique nachzulesen war, „,Arabische‘ Nomaden, die Wasser- und Weideland für ihre Tiere brauchen, gegen ‚afrikanische‘ Bauern (kämpfen), die die kargen Erträge ihres Bodens schützen wollen“ (Mai 2004), überzeugt ebensowenig, bleibt so doch die unvorstellbare Brutalität, mit der paramilitärische wie offizielle Truppen vorgehen, rätselhaft. Und auch die These, daß es allein die blanke Gier nach Petrodollars sei, wie einige nicht müde werden zu behaupten, die zu Mord und Totschlag anstifte, ist zweifelhaft, waren die Auseinandersetzungen doch im ganzen Land schon im Gange, bevor überhaupt der erste Barrel Öl gefördert worden war.
Ausschluß der Schwarzafrikaner
Als im Gebiet des heutigen Sudan in den 40er Jahren Unabhängigkeitsforderungen laut wurden, entwickelte die britische Kolonialverwaltung Pläne zur Zweiteilung des Landes: Der vorwiegend von moslemischen Arabern bewohnte Nordsudan sollte unabhängig werden, und der Süden des Landes an die ostafrikanischen Kolonien angeschlossen werden. Mit der Konferenz von Juba im Jahr 1947 ließ Großbritannien allerdings von diesem Plan ab, dem sich die Nordsudanesen widersetzten, die sich den Zugriff auf die fruchtbaren Ebenen im Süden nicht nehmen lassen wollten. Zu instabil schätzte man zudem den Süden ein, zu groß den Entwicklungsrückstand dieses ökonomisch vernachlässigten Gebietes und zu zerstritten erschienen die verschiedenen südsudanesischen Stämme untereinander. Ausschlaggebend für die Entscheidung der Briten war schließlich die Machtübernahme Nassers 1952 in Ägypten: Ein unabhängiger nordsudanesischer Staat könne dem Vorbild Ägyptens folgen und eine Allianz mit der Sowjetunion eingehen, während ein geeinter starker Sudan mit westlicher Anbindung einen gewissen Ausgleich in der Region schaffe. Schon vor der Unabhängigkeit entbrannte im Sudan aber der Streit über die zukünftige Verfassung des Landes: Demokratisch, föderal und säkular habe der Sudan zu sein, meinte man im Süden, islamisch und zentralistisch ausgerichtet stellte man sich den neuen Staat im Norden vor. Mit der Machtübergabe an die an islamischen ägyptischen Universitäten entsprechend ausgebildeten, arabisierten Eliten in Khartoum spitzte sich der Konflikt weiter zu, denn auch im Norden der neuen Republik war man sich nicht einig: Einige, insbesondere die sudanesischen Nasseristen und Angehörigen der Baath-Partei, die panarabisch orientiert waren, stimmten für die enge Anbindung des Sudans an Ägypten und andere arabisch-sozialistisch orientierte Länder – wie später der Irak oder auch Syrien –, andere redeten der Errichtung einer geschlossenen islamischen Republik das Wort, und noch andere bastelten an einer neuen Identität – natürlich unter Einbeziehung des islamischen Glaubens. Einig war man sich im Norden nur in zwei Punkten: daß der entstehende Staat islamisch geprägt sein solle und mit den „ungläubigen“ Südsudanesen nach alter Sitte verfahren werden müsse: Wenn man sie schon nicht versklaven könne wie einst, seien sie aus dem öffentlichen Leben des Staates soweit wie möglich auszuschließen. Doch die Südsudanesen gaben nicht nach und hielten an ihrer Forderung nach einer Verfassung nach britischem Vorbild fest, welche nicht nur einen säkularen Staat festgeschrieben, sondern ihnen auch völlige Gleichberechtigung zugesichert hätte: Schon vor der Unabhängigkeit des Sudan brach der erste Bürgerkrieg aus. 1958 putschte sich dann General Aboud an die Macht, ein Befürworter des nationalen islamischen Weges. Er beschuldigte seine zivilen Vorgänger, den „wahren“ Islam Arabiens verraten zu haben und startete einen militärischen Feldzug zur Homogenisierung und d.h. zur Islamisierung des Landes: Die Ausübung anderer Religionen wurde unter Strafe gestellt und der Versuch unternommen, den Süden mittels großangelegter Missionierungskampagnen in eine gesamtsudanesische islamische Gemeinschaft einzugliedern. Doch die Repressionen stachelten den Widerstand der christlichen und animistischen Südsudanesen erst richtig an: Anfang der 60er Jahre verbanden sich verschiedene, bisher autonom operierende Rebellengruppen zur Anya Nya (Schlangengift) und trugen – logistisch unterstützt durch Israel, welches ihnen via Uganda Waffen zukommen ließ – das ihre zum Sturz des Diktators bei. Drei Jahre später – die Mitglieder der Anya Nya waren untereinander wegen politischer Differenzen zwischenzeitlich heillos zerstritten – begann eine neue Verfassungsdebatte, bei der erstmals deutlich wurde, wes Geistes Kind die panarabisch orientierten Islamisten des Nordens eigentlich sind: Der Entwurf, an welchem Hassan al-Turabi, ein Anhänger der Moslembruderschaft, der später die National Islamic Front (NIF) gründen sollte und Sadig al-Mahdi, ein Nachfahre des „von Gott geleiteten“ Propheten, maßgeblich beteiligt waren, sah nämlich nicht nur die Einführung der Sharia und das Verbot aller „gottlosen“ Auswüchse – namentlich Atheismus, Christentum, animistische Religionen und den Kommunismus – vor, sondern forderte auch das Verbot des passiven Wahlrechtes für alle nichtmoslemischen und nichtarabischen Einwohner des Landes, also den Ausschluß aller Schwarzafrikaner – Christen, Animisten wie auch Moslems – aus dem Parlament. Die Gefahr, Angehörige der eigenen „Rasse“ aus dem Parlament auszuschließen, bestand nicht, handelt es sich bei den Arabern des Sudan doch zu fast 100% um bekennende Moslems. Im Gegensatz zu dem osmanischen Sultan Abdul Hamid II., der für die Zusammenarbeit „aller islamischen Völker“ mit dem Ziel, einen modernen allislamischen Bund zu errichten, warb, träumten al-Turabi und andere Anhänger der panarabischen Idee von einem Großarabien – sei dieses nun politisch geeint oder in verschiedene arabische Staaten zergliedert. Nicht mehr der Glaube galt ihnen als verbindendes Moment, sondern die Abstammung: Der allarabische hatte den allislamischen Gedanken abgelöst.
Mit dieser politischen Entrechtung der schwarzen Bevölkerung des Sudan ging eine „Politik der verbrannten Erde“ einher. Ganze Dörfer wurden niedergebrannt, Ernten zerstört, Massaker an der schwarzen Bevölkerung verübt und die überlebenden Einwohner der betreffenden Orte in den Norden verschleppt, wo sie – wie einst ihre Vorfahren – unter Bedingungen, die denen in der Sklaverei in nichts nachstanden, ihr Dasein fristeten.
Der Weg der Islamisierung
Im Mai 1969 schien dieser Zustand ein vorläufiges Ende gefunden zu haben: Durch den Staatsstreich al-Numeiris, eines panarabischen Nasseristen, den Sozialisten wie Kommunisten unterstützten, wurde die Errichtung einer präsidalen islamischen Republik verhindert und 1972 in Addis Abeba ein Friedensabkommen zwischen der Regierung und den südsudanesischen Rebellen unterzeichnet: Dem immer noch völlig unentwickelten Süden wurde ein eigenes Parlament und eine gewisse Autonomie zugestanden, es wurden Förderungsmaßnahmen wie etwa der Bau einer Universität in der südsudanesischen Hauptstadt Juba eingeleitet und die Anya Nya in die reguläre Armee eingegliedert. Doch schon bald änderte sich die Lage im Sudan erneut: Nachdem die Köpfe der führenden Kommunisten und Sozialisten nach einem gescheiterten Putschversuch abgeschlagen, beide Parteien kriminalisiert worden waren, und sich das Land in einer schweren Wirtschaftskrise befand, welche die unzufriedene Bevölkerung zu Aufständen veranlaßte, besann sich Numeiri zusehends auf seine arabisch-islamischen Wurzeln: Er distanzierte sich von den staatssozialistischen Ideen der Nasseristen und Baathisten und propagierte – ganz im Sinne der Umma-Partei – den Islam als einziges wahre Einheit schaffendes Moment. Konsequent führte er 1972 ein Einparteiensystem ein. 1977 verbündete er sich offen mit der al-Ansar/Umma Party, deren Ziel es war, „shawa islamia“, d.h. das islamische Erwachen zu fördern, sowie der Partei der Muslimbrüder um al-Turabi, und ließ sich zum „Herrscher der Gläubigen“ ernennen. Ende der 70er Jahre ordnete er schließlich sogar die Säuberung Khartoums an: Da immer mehr schwarze Sudanesen dort ansässig wurden – sei es, da sie dorthin verschleppt wurden, um dort die anfallenden „niederen“ Arbeiten zu verrichten, sei es, weil sei vor dem Bürgerkrieg im Süden in den Norden geflüchtet waren –, fürchtete die arabische Bevölkerung der Hauptstadt die „rassische Überfremdung“ und meldete Handlungsbedarf an. Alle Angehörigen der „schwarzen Rasse“, derer die Truppen der Regierung habhaft werden konnten, gleich welcher Religion, wurden daraufhin in Lager gepfercht und in den Süden deportiert.
Eine weitere Etappe auf dem Weg der Islamisierung wurde 1983 zurückgelegt, als Numeiri die Sharia als einziges und für alle geltendes Recht einsetzte. Auch im Süden des Landes gelten seitdem Kopftuchzwang und Alkoholverbot und Verstöße gegen das islamische Gesetz werden seither, wie in allen anderen islamischen Staaten auch, etwa mit Auspeitschungen z.B. bei Vergewaltigung, Amputation einer Hand und eines Fußes z.B. bei Diebstahl oder gar dem Tod z.B. beim Abfall vom Islam geahndet. Die Gesetze des Islam dienten zusehends der bloßen Legitimation der (macht-)politischen Interessen der arabischen Eliten in Khartoum und so wurde auch der Friedensvertrag mit der Anya Nya kurzerhand mit der Begründung für nichtig erklärt, daß die islamisch-arabische Traditon lehre, daß Verträge, die mit Ungläubigen abgeschlossen werden, für „wahre Gläubige“ nicht bindend seien.
Um den Widerstand endgültig zu brechen, betrieb die Regierung Numeiris zeitgleich eine Politik der wirtschaftlichen Destabilisierung des ohnehin unterentwickelten Südens wie auch des Westens und Ostens des Landes: Durch den Bau von Kanälen etwa wurde den Bauern verschiedener Regionen buchstäblich das Wasser abgegraben, begonnene Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur wie der Bau von Straßen wurden eingestellt, so daß auch heute noch weite Gebiete im Süden und Westen des Landes von der Welt abgeschnitten sind. Das Öl, welches seit 1978 im Südosten des Landes gefördert wird, wurde und wird zu Raffinerien im Norden des Landes gebracht, und von dem eingenommenen Geld – insbesondere China und Frankreich haben für alle Beteiligten lukrative Verträge mit der sudanesischen Regierung geschlossen –, werden v.a. Waffen aus der Schweiz oder aus Rußland eingekauft, die in den verschiedenen entlegenen Landesteilen dann gegen die Bevölkerung eingesetzt werden.
Heiliger Krieg – mit Gas und Deportation
Mit dem gelungenen Staatsstreich von Oberst al-Bashir, der von der NIF um al-Turabi unterstützt wurde, verschärfte sich die Situation im Sudan erneut. Bashir, der auf ägyptischer Seite im Jom-Kippur-Krieg gegen Israel kämpfte, und sein Kabinett gelobten nun, endgültig „das Reich Gottes auf dem Boden des Sudan zu errichten“ sowie das „ganze Land zu islamisieren“(2). Sie riefen eine Republik aus, in welcher der Islam, wie im Iran, offizielle Staatsphilosphie wurde. Zugleich erklärten sie allen „Ungläubigen“ den Djihad und trieben die Zwangsarabisierung aller gesellschaftlichen Bereiche voran: Arabisch wurde zur einzig erlaubten Sprache ernannt, die Ausübung überlieferter afrikanischer Bräuche unter Strafe gestellt, alle christlichen und säkularen Schulen geschlossen und durch Koranschulen ersetzt, denen natürlich nur Jungen beitreten dürfen, die dort zu tapferen Mudschaheddin für den „heiligen Krieg“ gegen Ungläubige im eigenen Land wie auch gegen Israel und die USA erzogen werden. Verstöße gegen das islamische Recht werden seitdem nicht nur mit brutalen körperlichen Strafen sanktioniert, sondern die Strafe, wie unter den Taliban in Afghanistan, in der Öffentlichkeit vor johlender Menge vollstreckt.
Daß Zwangsarabisierung aber noch ganz andere Dinge impliziert, bezeugen die Maßnahmen, die Bashir gegen die südsudanesische Bevölkerung ergriff: Erstmals ging die Armee auch mit Giftgas gegen südsudanesische Dörfer vor; Kinder wie junge Frauen wurden, wenn sie von den umherziehenden Banden im Namen des Islam nicht massakriert wurden, in den Norden des Landes deportiert – die einen, um dort in islamischen Heimen zu wahren Gläubigen umerzogen und zu Kanonenfutter für den Djihad ausgebildet zu werden, die anderen, um in arabischen Haushalten die niederen Arbeiten zu verrichten und den Haushaltsvorständen auf noch ganz andere Art zu Diensten zu sein. Junge Männer wurden zu oft tödlicher Zwangsarbeit z.B. für den Bau von Kanälen verpflichtet, unbrauchbare Alte einfach dem Hungertod überlassen und so die Vernichtung der schwarzafrikanischen Population des Landes vorangetrieben.
Bin Ladens Wahlheimat
Unter der Führung al-Turabis, dem ideologischen Kopf hinter dem Militär Bashir, entwickelte sich der Sudan in den 90er Jahren zu einem attraktiven Stützpunkt für islamistische Gruppierungen: 1991 gründete al-Turabi die Popular Arab and Islamic Conference (PAIC), einen internationalen Dachverband radikal islamistischer Kräfte, der alle fundamentalistisch orientierten islamischen Regime angehören, und 1991 war auch das Jahr in dem Osama bin Laden, der wegen seiner Verstrickung in verschiedene terroristische Aktionen gegen amerikanische Einrichtungen aus Saudi-Arabien ausgewiesen worden war, im Sudan Asyl fand. Dort war er willkommener Gast, finanzierte er doch nicht nur diverse Bauvorhaben der Regierung, sondern unterstützte Ausbildung wie Unterhalt der von der Regierung gehätschelten Mudschaheddin, die sich weltweit im Kampf für den Islam hervortaten und -tun: Es wird angenommen, daß sowohl der erste Anschlag auf das WTC wie auch das Attentat auf den ägyptischen Präsidenten Mubarak in Addis Abeba 1995 maßgeblich von im Sudan ansässigen Terroristen vorbereitet wurden. Die USA setzten den Sudan denn auch schon 1993 auf die Liste der „Schurkenstaaten“ und Clinton verhängte 1997 umfangreiche Wirtschaftssanktionen gegen das Land, so daß sich Bashir 1996 genötigt sah, zumindest bin Laden nach Afghanistan abzuschieben. Zu einem nach außen moderat erscheinenden Kurs fand die Regierung allerdings erst, nachdem als Reaktion auf die Anschläge auf US-Botschaften in Nairobi und Dar-es-Salaam eine sudanesische Arzneimittelfabrik, von der angenommen wurde, daß in ihr Nervengas produziert werde, von amerikanischen Cruise-Missiles zerstört wurde: 1999 überwarf sich Bashir, der die gewaltsame Absetzung seines Regimes durch ausländische Truppen und zudem den Bankrott eines Landes fürchtete, das durch den fortdauernden Bürgerkrieg am Rand des finanziellen Ruins stand, mit dem überzeugten Muslimbruder al-Turabi, der zeitweise sogar inhaftiert wurde. Pflichtschuldigst wurde zumindest versucht, dem Sudan den Anschein von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu geben: Exilpolitiker wie al-Nimeiri konnten zurückkehren, mehrere Parteien wurden zugelassen und im Jahr 2000 fanden erstmalig wieder Wahlen statt, die zwar so frei und geheim nicht waren und von den oppositionellen Parteien, welche ähnlich wie im Irak unter Saddam von der Regierung eingeschüchtert worden waren, von vornherein boykottiert wurden, so daß Bashir immense Stimmenanteile auf sich vereinigen konnte, von den USA als Geste aber sehr wohl verstanden wurden. Nach dem 11. September „bemühte sich Bashir sicherheitshalber, den Terror des Al-Quaida-Chefs (...) zu verdammen“ anstatt wie sein einstiger Kompagnon gegen „jene arabischen und islamischen Staaten“ zu wettern, „die die USA in ihrem Krieg unterstützen und ihre Erde und ihren Himmel den Kreuzrittern und Juden ausliefern’“ (iz3w 260/02), und schafft es seither, sich mit dergleichen vermeintlichen Zugeständnissen an die demokratische Welt „den – ohnehin geringen – internationalen Ärger vom Hals“ zu halten. (Welt Kompakt, 25.05.04)
Blut und Boden
In einer Erklärung, die am 27. Mai diesen Jahres ebenfalls unter Druck und nach langen Vermittlungsbemühungen der USA unterzeichnet wurde, erklären denn auch SPLA/M und Regierung nach Jahrzehnten des Bürgerkrieges die Absicht, miteinander Frieden zu schließen und legen die Bedingungen fest, die für einen solchen die Voraussetzungen bilden sollen – der Krieg in Darfur findet in diesem Dokument allerdings keinerlei Erwähnung, so daß die Regierung dort frei von Verträgen und Skrupeln vorgehen kann – und das, obwohl die SPLA/M und die SLA in einem gemeinsamen Dachverband, der National Democratic Alliance (NDA) organisiert sind, und obwohl es oberflächlich so aussieht, als föchten die Rebellen im Westen des Landes den gleichen Kampf aus wie die im Süden.
Und doch unterscheiden sich die beiden Konflikte in einem entscheidenden Detail: Die schwarzafrikanischen Einwohner Darfurs glauben wie ihre Feinde an Allah, der Anführer der JEM, Kahlil Ibrahim, gehörte sogar lange Zeit der islamistischen Partei al-Turabis an – und doch erfahren sie weder von ihren Glaubensbrüdern und -schwestern in Khartoum noch von den Mitgliedsstaaten der Arabischen Liga irgendeine Form der Unterstützung oder Solidarität. Ihnen ergeht es wie den polnischen, ukrainischen, rumänischen und anderen Hilfstruppen der Deutschen, die sich den Nazis als besonders überzeugte Judenfeinde anzudienen versuchten: Nichts, keine Mordtat – eine Vielzahl der im Südsudan stationierten Truppen rekrutierte sich aus Angehörigen der vorwiegend islamisch ausgerichteten Stämme Darfurs –, kein noch so überzeugend vorgetragenes Glaubensbekenntnis vermag in den Augen der arabischen Machthaber in Khartoum den Makel ihrer Herkunft verdecken. Wie einst die Deutschen hängen auch die sudanesischen Araber einer „arabischen Vision“ an, träumen von einem Großarabien, eingebunden in die mächtige Gemeinschaft der Umma, in der für andere „Rassen“ nur dann Platz ist, wenn diese sich mit der Rolle von Sklaven und Leibeigenen bescheiden, die die Lebensgrundlage der anderen erwirtschaften: „Hellhäutige Araber fühlen sich“, wie die Welt schreibt, „nach wie vor als Herrenmenschen, die dazu ausersehen sind, die Schwarzen zu beherrschen“ (12.05.04). Und da ein Volk bekanntlich Raum braucht, zumindest bewohnbarem Raum im Sudan aber eher knapp bemessen ist, muß der zur Verfügung stehende entvölkert werden, um Platz zu schaffen für die Angehörigen des einzig wahren Volkes dieser Erde: die Araber, ausersehen von Allah, die Vorherrschaft auf Erden zu erringen.
Wie schon im Südsudan, wo die ökonomisch wertvollen, weil fruchtbaren oder auch erdölreichen Gegenden, von Milizen und Armee entvölkert wurden, um dort arabischstämmige Menschen anzusiedeln, geht man auch in Darfur vor: Ausgedehnte Regionen werden von der Regierung abgeriegelt und verwüstet: „Erst kamen die Flugzeuge. Nach den Luftangriffen folgten die Reitermilizen“ (Der Standard, 17.07.2004), die ihrem offiziellen „Auftrag: Zerstört die Dörfer, vertreibt die Menschen“ (Welt, 12.05.2004) möglichst effektiv nachzukommen versuchen. Nach dem üblichen Modus Operandi massakrieren sie ganze Dörfer und zünden an, was nach ihrem Einfall noch steht, stehlen den Menschen ihr Vieh, ihre Ernte und die Wasserquellen und treiben „die übrige Bevölkerung, sofern sie sich retten kann“ (Welt, 24.07.2004), in die Flucht, die oftmals den Tod bedeutet und auch bedeuten soll, denn Hilfslieferungen der internationalen Gemeinschaft werden von Khartoum gezielt verhindert, damit der Hunger vollendet, was Djandjawid und offizielle Truppen nicht geschafft haben. Daß es den Islamisten auf keine Glaubensinhalte ankommt, daß ihnen der Islam das Ticket liefert, mit der sie ihre Vernichtungswünsche rationalisieren können, illustriert dabei folgendes Detail: „Neben den Behausungen wurden meist auch die Moscheen der Schwarzafrikaner zerstört, was kein überzeugter Moslem je tun würde.“ (FAZ, 28.07.04)
„In den von [wie die Regierung in Khartoum sich ausdrückt] ‚gesetzlosen Elementen gesäuberten‘ Gebieten sollen arabischstämmige Nomaden angesiedelt und die Vertreibung der Schwarzafrikaner somit unumkehrbar gemacht werden,“ (FAZ, 21.07.04) der wenige fruchtbare Raum im von Desertifikation bedrohtem Darfur an Angehörige der arabischen „Herrenrasse“ übergeben werden – so wie einst das gute Land in Osteuropa an sogenannte Volksdeutsche.
„Völkermord“ und Massenmord
Mit den Staaten der Arabischen Liga ist sich die überwiegende Anzahl der UN-Mitgliedsländer darin einig, daß ein entschiedenes Vorgehen im Sudan eine unzulässige „Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes“ sei. Wie im Falle einer geplanten Resolution gegen Simbabwe bevorzugt man auch bezüglich des Sudan die „Sprache von Kooperation und Dialog“ – Rücksichten, die die „Vereinten Nationen nicht einen Moment lang aufhalten, wenn es an die unerbittliche Verfolgung Israels geht“, wie die US-amerikanische Politologieprofessorin Anne Bayefsky zurecht feststellt (Konkret, 06/04). Und obwohl in Darfur kein Ende des Mordens in Sicht ist und auch die Kämpfe im Süden des Sudan erneut aufflammen, setzt man auch hierzulande darauf, den arabischen Massenmördern in Khartoum mit „vernünftigen“ Argumenten ins Gewissen zu reden und sie so von ihrem Tun abzubringen. Es ist, als hätte man einst die Mordbanden in Ruanda am runden Tisch zur Räson bringen können.
Und auch in den USA ertönen die „Rufe nach Einmischung“ gar nicht so „schrill“, wie der größte investigative Journalist aller Zeiten, Jürgen Elsässer, sie zu beobachten meint, wenn er schreibt, es werde von Washington und Berlin „mit unüberprüfbaren Meldungen die Interventionshysterie geschürt“ (junge Welt, 29.05.2004). In den USA setzt man vielmehr, wie einst in Großbritannien darauf, daß nach einem gelungenen Friedensschluß zwischen Nord- und Südsudan dem sogenannten Westen freundlich gesinnte Kräfte an der Regierung beteiligt sein werden und verhindern, daß die zur Zeit herrschende auch die zukünftige Staatsdoktrin sein und so das vorgeblich im Namen Allahs begangene Morden beendet werden wird.
Daß die UNO-Mehrheit im Falle des Sudan zu benennen und zu tun sich weigert, was sie im Falle Israels oder der USA selbstverständlich täte, das, was im Sudan geschieht, als „Völkermord“ zu bezeichnen und entsprechend zu intervenieren, mag oberflächlich als logische Inkonsequenz erscheinen. Aber es handelt sich dabei um einen in der Sache liegenden Widerspruch und nichts wäre unangebrachter, ihn moralisch empört anzuprangern. Es ist kein Zufall, daß in den einschlägigen UN-Konventionen und -Resolutionen nie von Massenmord, sondern von „Völkermord“ die Rede ist. Im Gegensatz zum Begriff des „Massenmords“, der nach einer Bemerkung von Eike Geisel in sich zum Ausdruck bringt, daß die Metzeleien der Neuzeit Verbrechen an Massen und Verbrechen von Massen waren, das Kollektiv also nicht nur als Objekt, sondern als destruktiv handelndes Subjekt anspricht, erscheint beim „Völkermord“ das Kollektiv rein als Opfer und der Mörder als ein ebenso rein äußerliches Subjekt, das selbst nicht nur kein Volk sein kann, sondern dessen Daseinsbestimmung darin liegt, die Völker ihrer Würde, Identität und schließlich ihrer Existenz zu berauben. Die Kategorie des „Völkermords“ ist eine Generalklausel und sie deckt das souveräne Kalkül der UNO-Mehrheit, Massenmorde entweder dem staatlich organisierten Völkerfeind Israel in die Schuhe zu schieben, wo dies irgend möglich ist oder im Stil der ehrenwerten Gesellschaft, das entsprechende Geschehen als eine Familienangelegenheit zu betrachten, bei der man sich irgendwelche Einmischungen, als wiederum von den Völkerfeinden ausgehende „Kriegstreiberei“ o.ä., verbietet. Aktionismus und Indifferenz, beide für die UN so charakteristischen Haltungen, entpuppen sich als zwei Seiten derselben Medaille, die auf alle Fälle gegen die Juden Verwendung findet oder gegen ein Ersatzobjekt, wie vor Jahren gegen die Serben.
So ist es vielleicht ehrenwert, aber hilflos, wenn beide Häuser des US-Kongresses die Geschehnisse in Darfur als „Genozid“ (vgl. Tagesspiegel, 29.07.2004) bezeichnen und damit versuchen, das Ideal gegen die Wirklichkeit ins Feld zu führen. Andere sind da gewiefter: Das Ganze seien zwar „im Ergebnis ethnische Vertreibungen“, so die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Kerstin Müller, am 28.06. im Deutschlandfunk, und „es ‚wäre’“ irgendwie „schon wichtig‘, wenn der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen“ sich zu einem Beschluß durchränge, denn schließlich, so Außenminister Fischer: „Das Morden muß ein Ende haben“ (FAZ, 29.07.04). Wie die von der Leine gelassenen Milizen und die sie protegierende Regierung allerdings – ohne zum Mittel der militärischen Intervention zu greifen – effektiv gestoppt werden sollen, bleibt rätselhaft: „Die parlamentarische Staatssekretärin im Entwicklungsministerium, Eid,“ empfiehlt „Reisebeschränkungen für sudanesische Regierungsmitglieder oder die Sperrung ausländischer Konten als Beispiele für geeignete Sanktionsmaßnahmen“ (ebenda) – ganz so als wüßte nicht ein jeder, daß das Vermögen des Sudan eh bei islamischen Banken angelegt ist, die sich hüten werden, sich an derlei Maßnahmen zu beteiligen, und als wäre es usus, daß Bashir und al-Taha ihren Jahresurlaub im schönen Mecklenburg verbrächten. International hat man sich darauf geeinigt, die Vorgänge als „ein an Völkermord grenzendes Geschehen“ (taz, 01.07.2004) zu bezeichnen. Am 30. Juli verabschiedete denn auch der Sicherheitsrat der UN nach langen Verhandlungen eine Resolution, in der die Regierung in Khartoum freundlichst dazu aufgefordert wird, die „Verfolgungen“ (NZZ, 31.07./01.08.04) in Darfur zu beenden und die Milizen zu entwaffnen. Sanktionen bei Nichterfüllung der Forderungen werden nicht angedroht. UNO at it’s best: Mitte Juni beschließt „die Weltgemeinschaft in ungewöhnlicher Eile eine UN-Truppe für die Umsetzung eines Friedensvertrages [zwischen der Regierung und der SPLA], den es noch gar nicht gibt, der Katastrophe in Darfur aber begegnet sie weiterhin nur mit Appellen“ (SZ, 14.06.2004).
Eine Atempause für die Mörder
Das islamistische Regime in Khartoum hat damit eine weitere Atempause gewonnen, von der zu befürchten ist, daß sie sie nutzen wird, „um im Westsudan mit aller Gewalt und den im Süden freigesetzten militärischen Ressourcen den Krieg zu Ende“ (Blätter für deutsche und internationale Politik, 07/04) zu führen und schließlich den „totalen Sieg“ zu verkünden, den errungen zu haben Bashir schon im April dieses Jahres erhoffte und der nur eines heißen kann: auch der letzte Schwarze hat das Land verlassen oder in Darfur den Tod gefunden. Damit scheint die übliche Besänftigungsstrategie der Regierung Bashir erneut aufgegangen zu sein: Nachdem Kofi Annan den Sudan besuchte und sowohl die Entwaffnung der Milizen wie auch die juristische Aufarbeitung der von ihnen begangenen Verbrechen forderte, ließ die sudanesische Regierung zehn Mitglieder der Djandjawid verhaften und wegen Mordes, Plünderung und illegalen Waffenbesitzes zu sechs Jahren Haft sowie öffentlicher Kreuzamputation (rechte Hand, linker Fuß) verurteilen. Die internationale Gemeinschaft verstand diese Geste und nahm sie dankbar zur Kenntnis.
Auch wenn in Khartoum am 5. August 100.000 Menschen gegen die Resolution der UN demonstrierten, weiß dort jeder, daß mit dieser Resolution die Intervention internationaler Truppen im Sudan in weite Ferne gerückt ist – und das nicht etwa, weil das sudanesische Kabinett Mitte Juli die „politische und strategische Mobilmachung“ verkündete und ankündigte, einen „Einsatz internationaler Truppen“ nicht nur „entschieden abzulehnen“, sondern auch „angemessen mit jedem Soldaten (zu) verfahren, der seinen Fuß auf sudanesisches Land setzt“ (FAZ, 29.07.04), und somit Amerikanern wie Briten „einen Empfang zu bereiten, schlimmer als im Irak“ (Tagesspiegel, 29.07.04), wie es der sudanesische Landwirtschaftsminister El-Chalifa Ahmed Ende Juli formulierte.
Man kann sie sich schon vorstellen, die Zeitungsschlagzeilen im Jahre 2014: „1994: Völkermord in Ruanda! 2004: Genozid in Darfur! Nie wieder!“. Und reichten dann die Staaten der Arabischen Liga eine Resolution ein, in der sie ein entschiedenes militärisches Vorgehen der internationalen Gemeinschaft gegen Israel fordern, um dem „Genozid an den Palästinensern“ vorzubeugen, wird keiner darauf hinweisen, daß auch Israel das Recht habe, „seine Bevölkerung vor Terrorismus zu schützen“, wie es jüngst Syrien und China taten, als eine Abstimmung über eine Resolution auf der Tagesordnung der UNO stand, in der Rußland aufgrund seines Vorgehens in Tschetschenien verurteilt werden sollte. Deutschland wird es sicherlich nicht sein, denn hier erhebt sich auch heute schon kein Widerspruch, wenn etwa auf einer Diskussions-Veranstaltung der Heinrich Böll-Stiftung zu den Zuständen in Darfur ein Orientalist mit schlafwandlerischer Sicherheit zum eigentlichen Kern der Menschenrechtspolitik à la UN vordringt und unschuldig fragt, ob es nicht recht eigentlich mehr als nachvollziehbar wäre, wenn die arabischen Staaten in nächster Zukunft auch einen Blauhelmeinsatz in Israel forderten.
Zu hoffen bleibt also nur, daß die USA nicht den von ihnen in den letzten Jahren eingeschlagenen Kurs verlassen und weiterhin an der Seite von Israel stehen werden, sondern auch weiterhin Regime, die zugunsten von mehr Islam auch mehr Terror verbreiten, in die Liste der „Schurkenstaaten“ aufnehmen und entsprechend behandeln werden.
Annmerkungen:
1) S. http://69.20.22.9/portals/benny/UN_WatchPetitionReZiegler.pdf, Übersetzungen aus dem Englischen hier und an anderer Stelle von der Autorin, N.W.
2) Vgl. Akok, Lado, Biel, Terrorismus im Namen des Islam und das Horn von Afrika, Marburg 2002.
Natascha Wilting (Bahamas 45 / 2004)
SPALTE3-AKTUELL-RUBRIK
Frühere Aktivitäten sind im Aktuell-Archiv aufgeführt. Dort gibt es auch einige Audio-Aufnahmen.
Alle bisher erschienenen Ausgaben der Bahamas finden Sie im Heft-Archiv jeweils mit Inhaltsverzeichnis, Editorial und drei online lesbaren Artikeln.