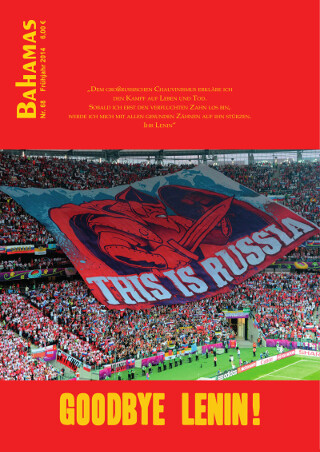Wider den Vorrang des Subjekts
Über materialistische Kritik und Kunst
Vom 29. 11. bis zum 1. 12. 2013 fand an der Berliner Humboldt-Universität die Konferenz Eine Erinnerung an die Zukunft statt, die sich der „Aktualisierung“ kritischer Theorie in der Gegenwart verschrieben hatte. Der folgende Text ist die ausgearbeitete Fassung eines Referats, das aus diesem Anlass dort am 29.11. vorgetragen wurde. Da es sich ausführlich mit dem Programm der Konferenz selbst beschäftigt, wurde die mündliche Vortragsweise beibehalten.
Zunächst möchte ich mich bei den Veranstaltern für die Gelegenheit bedanken, auf diesem Podium mit dem Titel „Materialistische Gesellschaftskritik unter veränderten Bedingungen“ sprechen zu können. Dass diese Dankbarkeit dann auch auf Ihrer Seite sein wird, wage ich allerdings zu bezweifeln, weil das, was ich Ihnen hier vorzutragen habe, Ihnen höchstwahrscheinlich nicht gefallen wird.
Wenn ich nämlich Titel, Ankündigungstext und das Programm dieses Kongresses richtig verstanden habe, dann läuft das Ganze so ab, dass hier zunächst die veränderten Bedingungen materialistischer Gesellschaftskritik im allgemeinen abgehandelt werden, die dann auf den anderen Podien anhand bestimmter Themen detailliert weiter erörtert werden, bevor die Veranstaltung in die unvermeidliche Endrunde mündet, in der nach absolvierter Analyse zunächst die „Aufgaben von Theorie und Politik“ diskutiert werden, bevor dann schlussendlich zwar nicht mehr die Frage nach dem „revolutionären Subjekt“, sondern – wir befinden uns ja in einem Kreis feinsinniger Theoretiker, die zudem aus der Geschichte der Linken gelernt haben – nach der „widerständigen Subjektivität“ gestellt wird. – Eine Frage, die aber bereits das Kongressprogramm selber durchzieht, wie sich dem Ankündigungstext entnehmen lässt: „Auf dem Weltmarkt werden Frauen, Lesben und Transgender weiterhin doppelt ausgebeutet und stellen einen großen Teil der ‚working poor’“, heißt es da. Die „feministischen Bewegungen“, so geht die Diagnose weiter, „statt aber zur allgemeinen Emanzipation von Staat und den kapitalistischen Produktionsverhältnissen beigetragen zu haben“, „wurden in die bestehende Ordnung integriert“ (1) – als wären die „feministischen Bewegungen“ ursprünglich oder ihrem Wesen nach je revolutionär und nur unter Aufbietung äußerster Gewalt zu zähmen gewesen und nicht, von ein paar minoritären Strömungen und Individuen abgesehen, in der Form ihres Argumentierens und Agierens nicht immer schon ein Moment dessen, wogegen sie sich richteten; als wäre angesichts allgegenwärtiger und institutionell gut verankerter Genderkampagnen nicht offensichtlich, dass gerade die „feministischen Bewegungen“ die Herausbildung jenes neuen und zugleich sehr alten und im übrigen geschlechtsneutralen Sozialcharakters vorangetrieben haben, der nach dem Motto „Ich leide, also bin ich“ sich einerseits unter Berufung auf die höchst unverwechselbare Diskriminierung, die ihm angeblich widerfährt, zur kleinsten existierenden Minderheit erklärt, sich nach dem Muster verfolgter und in ihrer Kultur bedrohter Völker begreift – und andererseits als Gegensouverän en miniature seine private, wahnhafte Feinderklärung allen anderen oktroyieren möchte und zu diesem Zweck sich mit anderen zu Rackets zusammenschließt, die unter sich und im Umgang mit der Außenwelt die formalisierten, auf Tausch beruhenden Verkehrsformen durch moralische Erpressung ersetzen. (2) Wenn das Schielen auf irgendeine „widerständige Subjektivität“ und damit die Option auf eine wie immer kritische oder fortschrittliche „Politik“ die Triebfeder der auf diesem Kongress zelebrierten theoretischen Anstrengung bilden sollte, dann wäre damit über diese auch schon entschieden und das heißt, dass man sich den ganzen Kongress im Grund auch schenken könnte. Nichts gegen irgendeinen Vortrag, der hier gehalten werden wird: Wie es immer auf solchen Kongressen zugeht, wird manches Kluge und mancher Unsinn erzählt werden. Aber wenn die Prämisse theoretischen Verhaltens die ist, einer „widerständigen Subjektivität“ mit den Mitteln von Politik aufhelfen zu wollen, dann beschädigt dies ein jegliches Theoretisieren, weil dieses dann, wie gehabt, zu einer Art Großfahndung nach den vermeintlich entscheidenden Widersprüchen, Rissen oder Brüchen im Gesellschaftsgefüge gerät und die Denkenden sich vorab zu Politingenieuren bzw. -kommissaren machen, die beanspruchen, kraft überlegener Ein- und Vorsicht diese Widersprüche gekonnt zu vertiefen und zu verschärfen: Statt in Erkenntnis frei zur Sache sich zu verhalten, wird aus Theorie eine „Ausleuchtung aller Winkel in systemverändernder Absicht“, wie Frank Böckelmann dies einmal genannt hat. (3)
Ein Apparat fix
Ein jegliches Bedürfnis nach Theorie, und zwar gerade eines, das sich auf die sogenannte Kritische Theorie beruft, muss sich die Frage gefallen lassen, worauf es sich richtet und mit welcher Haltung es einhergeht – ob es zur Erkenntnis einer Sache geleitet, um als ein Moment in ihr zu verschwinden, oder ob es sich borniert als abgesondertes Moment behauptet, indem es sich über die jeweiligen Gegenstände und Erfahrungen stellt, um über sie zu verfügen und die Welt gleichsam geistig zu kommandieren. Man kennt das aus der Geschichte der Linken und der Antideutschen zur Genüge: Auf diese Weise werden die materialen Erkenntnisse und Begriffe einer Kritik, wie Adorno, Horkheimer, Löwenthal und andere sie formuliert haben, unvermeidlich zu einem Apparat fix und fertiger Kategorien und Merksätze verdinglicht, die auf die jeweiligen Gegenstände nur noch appliziert werden müssen. Schlimmer noch: Sie werden als Gebrauchsanweisungen gelesen, die sich vor die lebendige Erfahrung schieben, anstatt diese zu erhellen
Dass diese altlinke Methode auf diesem Kongress höchstwahrscheinlich fortgeschrieben werden dürfte, ist gerade an jenen Teilen des Kongressprogramms ablesbar, die sich der Kunst und der ästhetischen Erfahrung widmen. Erkennbar wollen die Veranstalter sich abgrenzen von der überkommenen Masche, vor allem Theodor W. Adornos Denken, von dem er selbst in einem seiner letzten Interviews sagte, er empfinde es „als außerordentlich nah“ an seinen „künstlerischen Intentionen“ (4), auf Soziologie, auf wie immer kritische Gesellschaftswissenschaft zu reduzieren. Aber die Art und Weise, wie man nun der Kunst endlich gerecht zu werden hofft, lässt mich bezweifeln, ob damit tatsächlich ein Fortschritt verbunden ist. Die vorhin eröffnete Ausstellung „This is not a protest song. Ästhetische Interventionen jenseits des Immer-Gleichen“ mit Arbeiten aus den Bereichen Photographie, digitale Kunst, Objektkunst und Malerei wird nämlich wie folgt angekündigt: „Konfrontiert werden die Arbeiten mit ausgewählten Zitaten Walter Benjamins und Theodor W. Adornos zum Potential des autonomen Kunstwerks. Während die gezeigten Werke sich von Inhalt wie von der Form her kritisch mit der schlechten gesellschaftlichen Totalität auseinandersetzen, weisen Sie gleichsam, der Eigengesetzlichkeit der Kunst folgend, über diesen schlechten Zustand hinaus. Im Fokus der Ausstellung steht also das nicht-identische Moment der Kunstwerke, welchem sich die Ausstellung über eine begriffliche Auseinandersetzung anzunähern sucht.“
Das Subjekt ästhetischer Erfahrung
Von Oscar Wilde stammt die Bemerkung, ein Mensch sei „lediglich zur Betrachtung eines Kunstwerks eingeladen, um während des Betrachtens, sofern es sich um ein echtes Kunstwerk handelt, alle verblendete Voreingenommenheit zu vergessen – und zwar sowohl die aus Ignoranz als auch [die] aus Wissen geborene Voreingenommenheit.“ (5) Und weil Adorno und Benjamin hier geradezu mustergültig als Vehikel einer aus Wissen geborenen Voreingenommenheit herangezogen werden, ist eine solche Ankündigung der sicherste Weg, um ungegängelte Erfahrung der Kunst und ihrer Eigengesetzlichkeit zu verhindern und einer freien Urteilsbildung über das Objekt der Erfahrung von vornherein einen Riegel vorzuschieben. Zunächst einmal: Kein Künstler „setzt sich“, wenn er Kunst produziert, intentional „mit der schlechten gesellschaftlichen Totalität auseinander“, sondern mit einem bereits in sich vermittelten ästhetischen Material wie Sprache, Klänge, Bilder – und wenn er es dennoch tut, dann ist eine solche gesellschaftliche oder meinetwegen auch politische Intention allenfalls eine Erfindungshilfe, die zusammen mit anderen solcher Hilfen schließlich im Kunstwerk erlischt – ich rede hier nicht von Kunst-Propagandisten, deren Arbeit darin besteht, ästhetische Materialien zu Propagandazwecken zu arrangieren. Ob, in welchem Maße und in welcher Hinsicht das Kunstwerk in seiner erratischen Rätselhaftigkeit selbst etwas von der antagonistischen Totalität und was es darüber hinaus sonst noch so mitteilt, was also seine spezifische und unverwechselbare Welthaltigkeit ausmacht, die wiederum in seiner spezifischen Form und nirgendwo sonst beschlossen liegt, ist keine vorab ausgemachte Sache, sondern eine nachträgliche Reflexion, die ins Unabsehbare und Unverfügbare führt. „Potential des autonomen Kunstwerks“, das „nicht-identische Moment der Kunstwerke“, ja der Begriff der ästhetischen „Autonomie“ selbst sind notwendigerweise post-festum-Kategorien. Vor der „begrifflichen Auseinandersetzung“ mit dem Kunstwerk, von der der Text spricht, steht unabdingbar die Erfahrung des Kunstwerks – und die ist, darin dem sexuellen Begehren verwandt, gerade kein logisch geordneter und streng reglementierter Vorgang, sondern einer, bei dem es einem erst einmal die Sprache und die eingeschliffenen Begriffe verschlägt, nämlich ein Überfallen- und Überwältigtwerden des Subjekts, in dem seine konstitutive Illusion, es verfüge über die Welt und seine Erfahrung wie über einen Besitz, im Nu zerbricht, plötzlich etwas vom „Vorrang des Objekts“ aufscheint und die Perspektive sich eröffnet, dass das Subjekt seine identifizierende und subsumierende Tätigkeit gegen diese selbst kehrt und an das verschwendet, woran es seine verleugnete Substanz hat: die äußere wie die eigene (Trieb)-Natur. (6) Ästhetische Erfahrung geht gegen das, was Adorno des öfteren den „Besitzcharakter der Erfahrung“ nannte, wie die sexuellen Metaphern verraten, in denen wir unsere Fassungslosigkeit angesichts großer Kunst gemeinhin zu verbalisieren pflegen: Sie „berührt“, sie „bewegt“, sie „fesselt“, sie „bannt“ uns. Nicht das Subjekt also „hat“ Erfahrungen wie einen Besitz, sondern umgekehrt: Authentische Erfahrung hat das erfahrende Subjekt im Griff, lässt es nicht mehr los, treibt es um, und die logisch-diskursiven Formen der Erkenntnis sind in dieser Perspektive nichts anderes als der Versuch des Einzelnen, der Überwältigung und damit der Ohnmacht, der er ausgesetzt ist, sprachlichen Ausdruck zu verleihen und ihr zugleich standzuhalten, indem man sie begrifflich zu durchdringen unternimmt. Wo die ästhetische Erfahrung, die weder ein passives Registrieren eines Objekts noch die selbstherrliche Verfügung über es, sondern ein vorbehaltloses „In-der-Kunst-Sein“ ist, nicht selbst zur Reflexion weitertreibt, sondern wo Reflexionskategorien bloß äußerlich gesetzt, abgespult und angewandt werden, wird die Frage nach der Welthaltigkeit des Kunstwerks zur kategorialen Verdolmetschung des Alltagsverstands, der das Kunstwerk ja auch stets auf eine „Bedeutung“, eine „Aussage“, einen „Inhalt“, seit geraumer Zeit auch wieder auf ein „Engagement“ festnageln möchte. Wo die begriffliche Reflexion nicht als Organon unreglementierter Erfahrung fungiert, läuft sie leer und gerät umgekehrt zu einer Erfahrungsverhinderung mit System, vermittels welcher man sich, durch Adorno-Lektüre noch zusätzlich ertüchtigt, seine Erfahrung, oder besser gesagt seine Erfahrungsarmut, vorauseilend beglaubigen oder gar substituieren lässt.
Autonomie als Norm
Wie man aus der Geschichte der „Antideutschen“ in den letzten knapp 25 Jahren ersehen kann, kann unter solchen Umständen eine von unmittelbarer Anschauung unbeirrte Lektüre der Schriften von Horkheimer, Adorno etc. sogar richtiggehend Unheil anrichten, dergestalt, dass die sogenannte „Kritische Theorie“ selbst als Vehikel jener von ihr diagnostizierten Halbbildung fungiert, das heißt jene versierte Schlaumeierei und jenes gewitzte Bescheidwissen befördert, das sich vom Alltagsverstand nur noch unvorteilhaft durch größere Zähigkeit und energischeres Durchhaltevermögen unterscheidet. Insofern wäre im Interesse möglichst ungeschmälerter Erfahrungsfähigkeit von einem bienenfleißigen Studium der Werke der sogenannten „Kritischen Theorie“ und insbesondere der kunsttheoretischen Schriften Adornos sogar dringend abzuraten, denn im schlimmsten Fall helfen sie noch, jene Neigung zu bestärken, die sich bei Leuten, die es mit der „Kritischen Theorie“ halten, eh seit ein paar Jahren beobachten lässt: nämlich den von Adorno entwickelten Begriff avancierter autonomer Kunst selber zu fetischisieren, ihn komplett verdinglicht als Norm der eigenen Geschmacksbildung zu betrachten und alles, was dieser Norm nicht entspricht, mit völlig ungedecktem Snobismus als regressiv, banal etc. zu verurteilen. Aus dem Inneren der Kunst gespeiste und für die Kunst angestellte Überlegungen Adornos werden auf diese Weise einfach als Gebrauchs- und Handlungsanleitung benutzt und, mehr noch, als Katalog von „Ansprüchen“, die Kunstwerke zu erfüllen hätten, was dann eben regelmäßig zu den vom gesellschaftlichen Mainstream letztlich nicht mehr unterscheidbaren Postulaten führt, Kunst „müsse“ sich mit der gesellschaftlichen Totalität auseinandersetzen oder, wenns ganz dick kommt, zu jenen verquälten „Kunst nach Auschwitz“-Debatten, in denen dann allen Ernstes als Norm statuiert wird, dass nach der Massenvernichtung der Juden jede Musik atonal und jede Lyrik hermetisch zu sein habe – als seien die spröden und sperrigen Züge moderner Kunst ohne weiteres gesellschaftspolitisch deutbar als eine Widerspiegelung von und Reaktion auf Massenmord und Leiden, als würde nicht gerade die moderne Kunst in der Freiheit der Verfügung über ihr jeweiliges Material jedem, der sich ihr vorbehaltlos überlässt, bei allem Leid und aller Schwärze, die sie in sich aufnimmt und die Konfrontation mit ihr auch anstrengend machen, um ein Vielfaches mehr an Glückserfahrung und Lustbefriedigung bieten als die Kunst früherer Zeiten. (7)
Auch dieser Instrumentalisierung und Fetischisierung „großer Kunst“ wollen die Veranstalter dieses Kongresses entgegenwirken, denn sonst hätten sie nicht eine Lesung mit Texten von Eckhard Henscheid, der im übrigen keine „leichte Unterhaltung“, sondern Kunst produziert, aufs Programm gesetzt – leider nur ins Abendprogramm und mit der wie entschuldigenden und augenzwinkernden Vorbemerkung: „Leichte, doch wohl auch kritische Unterhaltung – maßgeblich geschöpft aus den satirischen Anekdoten Eckhard Henscheids, lesend vorgetragen.“ Wer sich also nur amüsieren möchte, bekommt Bescheid gesteckt: Unterhaltung ja, aber wiederum mit „Anspruch“, nämlich „kritisch“. Ebenso wenig, wie ich weiß, was, im Gegensatz zu Kunst, „engagierte Kunst“ ist, weiß ich, was, im Gegensatz zu intelligenter Unterhaltung, „kritische Unterhaltung“ sein soll – ich weiß nur sicher, dass die autonome bürgerliche Kunst wie das „ungehemmte Amusement“ (Horkheimer/Adorno) vor denselben Problemen stehen, seit es die kulturindustriellen Produktions- und Distributionsformen gibt, vermittels derer beiden Gestalten der Kunst ihre auf je eigene Art artikulierte Zweckfreiheit ausgetrieben wird, indem in ihnen die autonome Kunst auf konsumierbares Kulturgut herunter- und das Amusement zum „gehobenen Vergnügen“ gleichsam heraufwirtschaftet wird. Also: unterhaltende Literatur für die gehobenen Ansprüche angehender kritischer Theoretiker, aber bitte erst nach getaner Arbeit, zum Feierabend – wo es doch ein wirklicher Bruch mit den hergebrachten linken Konventionen gewesen wäre, hätte man Henscheids sprach- und bildmächtige Fabulierkunst oder seine unermüdliche Polemik gegen das mit Vorliebe auf Adorno und Benjamin rekurrierende gespreizte, prätentiöse und immerzu mit der Pose des Schwerdenkers angebende Theorie- und Kulturgeschwätz zum Gegenstand eines Workshops oder Podiums gemacht.
Überhaupt muss es einem auf scheinbar verlässliche Kategorien und verbindliche „Ansprüche“ erpichten theoretischen Bedürfnis systematisch entgehen, dass verbindliches Philosophieren heutzutage weder im philosophischen Seminar noch in außerakademischen philosophischen Zirkeln stattfindet, sondern in einer Unterhaltung, die ihrem Begriff gerecht wird, namentlich etwa in den Szenen und Vortragsstücken des Gerhard Polt, den ich ohne jedes Zögern als den bedeutendsten lebenden Gegenwartsphilosophen bezeichnen möchte. Mit traumwandlerischer Unbeirrtheit gelingt Polt nämlich etwas ganz Einfaches, was Adorno als Desiderat allen Philosophierens festhielt und worum sich viele kritische Theoretiker in ihren zähen, weitschweifigen und bräsigen Abhandlungen lebenslang vergeblich bemühen: ungeschmälerte Einsicht zu nehmen und mitzuteilen, das heißt zu erzählen, was einem an den Dingen aufgeht. (8) Von Gerhard Polts Kunst könnte man lernen, dass man seiner Erfahrung mächtig werden kann nur, indem man sich vorbehaltlos dem Objekt überantwortet, ihm sich anschmiegt, ja sogar gleichmacht – was deshalb so überzeugend gerät, weil Polt sich den Objekten seiner Erfahrung ganz ohne explizite Absicht der Demaskierung, der Denunziation oder selbst der Kritik, sondern mit aller Imagination zuwendet, deren er fähig ist, und das Erfahrene nur so weit zusammenrückt und verdichtet, dass es als eine über sich hinaus aufs Ganze verweisende Figur lesbar wird. (9)
Wenn authentische Kunst, einerlei ob es sich um autonome bürgerliche oder leichte Kunst handelt, denn überhaupt eine Funktion hat, dann die, urteilslos und vielmehr mit der ganzen Kraft der Formung, die sie dem jeweiligen ästhetischen Material angedeihen ließ, weil sie es ihm abgelauscht hat, gegen die Phrase und die Gewalt, die in ihr lauert, zu zeugen; authentische Kunst entgrenzt die menschliche Phantasie dadurch, dass diese gerade nicht bei sich selbst bleibt und autonom „erfindet“, sondern sich ans jeweilige ästhetische Material verschwendet und im selben Maß, wie sie es prägt, von ihm empfängt und eben dadurch dessen grenzenlosen Reichtum zur Darstellung bringt, an dem sich wiederum die Phantasie des Betrachters entzünden darf. Materialistische Kritik wiederum, um die es hier gehen soll, ist selber kein unmittelbar künstlerisches Verhalten, ihre Begriffe sind keine ästhetischen, und das markiert unverrückbar ihre Grenze zur Existentialontologie wie zum Poststrukturalismus – aber von der Kunst und künstlerischen Verfahrensweisen kann sie lernen, dass es in der Beziehung des Gedankens zur Sache nicht auf beständige Aktivität, auf allzeit bewusstes Machen, auf selbstgewisses Setzen oder geschäftiges Intervenieren ankommt, sondern auf das „passivische Moment“, das der Aktivität zugrunde liegt und auf das sie wiederum abzielt, indem sie in ihm verschwindet. Nicht auf die Verfügungsgewalt über eine Sache, sondern auf die Fähigkeit zur libidinösen Objektbesetzung, nicht auf souveränes „Entscheiden“ oder gar irgendeine „Verantwortung“, wie es im neuerdings gepflegten neoexistentialistischen Jargon heißt, sondern auf die Fähigkeit, sich dem Gegenstand zu überantworten. (10) Adorno hat diesen Zusammenhang einmal folgendermaßen formuliert: „Solange wir uns so verhalten, wie wir’s machen sollen, sind wir verloren […]. Wenn wir an einem Phänomen Kritik üben, dann ist es gar nicht so, dass wir ihm eine Richtung gäben und eigentlich keine geben können, sondern die Richtung liegt immer in der Sache […]. In der Frage nach der Richtung steckt noch ein Begriff der Subjektivität, der idealistisch ist und der so aussieht, als ob es vom Subjekt abhinge. Wer aber weiß, dass die Subjekte in der Realität hereinfallen, kann das Subjekt nicht so überfordern, dass er ihm zumutet, diese Richtung zu setzen. Erkennen ist nichts anderes als der Bewegung der Begriffe nachzugehen. Der subjektive Anteil reduziert sich auf das Moment der Spontaneität.“ Und weiter: „Ich brauche eigentlich meine ganze Spontaneität, um nichts zu tun, sondern nur zu sehen, was eigentlich ist. Ich muss mich mehr anstrengen, das zu tun, was ich nicht tue, sondern was getan wird […], Die Subjektivität steckt in der Erkenntnis in Form ihrer eigenen Negation. Eine Erkenntnis bietet alle unsere Erfahrungen auf, um Erfahrung zu vernichten.“ (11) Die „veränderten Bedingungen“ materialistischer Kritik, nach denen auf diesem Podium gefragt wird, sind keine, die ihr äußerlich wären und denen sie sich als autarke Methode konfrontiert, sondern sie sind in dieser selbstkritisch-materialistischen Wendung der Erkenntnistheorie bereits reflektierend aufgenommen. Wenn, wie Adorno andernorts schreibt, der „Materialismus […] keine durch Entschluss zu beziehende Gegenposition […], sondern der Inbegriff der Kritik am Idealismus und an der Realität, für welche der Idealismus optiert“ (12) ist, dann nimmt diese erkenntniskritische Destruktion an der Figur des souveränen, seiner selbst gewissen bürgerlichen Subjekts einen epochalen Vorgang in sich auf: nämlich den am Beginn des 20. Jahrhunderts unabweisbar gewordenen krisenhaften Zerfall des bürgerlichen Subjekts und der von ihm repräsentierten und in Gang gehaltenen liberalen Gesellschaftsordnung.
Dialektik des Zerfalls
Materialistische Kritik, wie Horkheimer, und Adorno sie formulierten, versucht sich nicht, wie immer wieder gern behauptet wird, einfach an einer „Rettung“ des Subjekts, sondern pointiert umgekehrt die Fähigkeiten und Kräfte, die im Zerfall des Subjekts freiwerden und ihm zuwachsen könnten – und die allererste dieser Fähigkeiten wäre, sich gerade nicht mit den schalen Posen wahlweise des selbstgewiss-selbstherrlichen Interventionisten oder einsam-unverstandenen Kritikers der Realität entgegenzusetzen, sondern seine eigene Zerfallenheit, seine Ohnmacht ungeschmälert ins Auge zu fassen, um ihr mächtig zu bleiben, anstatt sich von ihr dumm und panisch machen zu lassen. (13) In dieser Anstrengung hat die materialistische Kritik ihr Modell wie ihren Verbündeten in authentischen Gebilden der modernen Kunst, die ihre Formen ebenfalls nicht aus einem zweifelsfrei verbürgten Kanon beziehen, sondern aus der Reflexion gerade des irreversiblen Zerfalls der ästhetischen Subjektivität und der ihr zugeordneten ästhetischen Konventionen – und der es mit der daraus folgenden Intention, verbindliche Form aus Freiheit zu produzieren, in ihren besten Momenten gelingt, gegen die Gesellschaft aufzuzeigen und wachzuhalten, was am nachbürgerlichen Subjekt ein Versprechen und Vorschein eines Besseren wäre. In der Anstrengung, die eigene Ohnmacht gerade nicht zu verleugnen, sondern ihr unnachgiebig ins Auge zu sehen und sie in der geduldig-liebevollen Wendung zur Sache produktiv werden lassen, fungiert die materialistische Kritik ebenso wie die moderne Kunst gleichwelcher Provenienz als ebenso bestimmte wie in sich nuancierte Kritik jenes unerhellten und enthemmten Subjektivismus, wie er für das nachbürgerliche Subjekt typisch ist. Weil also moderne Kunst und materialistische Kritik in ihrem Erfahrungsgehalt und ihrer Intention zuinnerst konvergieren, verhält es sich so, dass die sogenannte „Kritische Theorie“, weit davon entfernt, eine wie immer „kritische“ Soziologie oder Gesellschaftstheorie darzustellen, nicht nur in der Erfahrung moderner Kunst irgendwie gründet, sondern im Grunde wenig mehr ist als die zum Selbstbewusstsein gebrachte ästhetische Moderne.
Wenn also auf diesem Podium, wie bei vergleichbaren linken Kongressen üblich, nach den „veränderten Bedingungen“ materialistischer Kritik gefragt wird, dann ist die Frage in dieser Form vorab verfehlt, unterstellt sie doch von vornherein die abstrakte Getrenntheit von Methode und Sache und damit eine instrumentelle Auffassung von Theorie als Mittel von Politik, d.h. es wird so getan, als seien die in Rede stehenden „Bedingungen“ ein kompaktes Ensemble vorgeordneter gesellschaftlicher Tatsachen und Tendenzen, das kritische Theoretiker begrifflich durchdringen sollen, um sich auf die Situation „einzustellen“ und ihre Möglichkeiten darin realistisch „einschätzen“ zu können. Die inflationäre und auch in der Ankündigung dieses Podiums wieder einmal bemühte Rede, wonach in der „Kritischen Theorie“ die Wahrheit einen „Zeitkern“ habe, ist deshalb mittlerweile zum Gegenteil dessen geworden, was mit ihr intendiert war: eine probate Legitimation für geschmeidige und betriebsame Anpassung ans gerade „gesellschaftlich“ Geforderte, sei es in der Politik oder in der individuellen Karriereplanung. Dass das auch unter Materialisten so beliebte Abheben gerade auf das dynamische Moment von Geschichte, auf die Aspekte der Veränderung, Entwicklung und Erneuerung sich bestens zur „konstruktiven Einschmiegung“ in den Gang der Dinge schickt, hat Adorno in den „Reflexionen zur Klassentheorie“ deutlich hervorgehoben und dagegen geltend gemacht: „Der andere, unbeliebtere Aspekt der Dialektik ist der statische […]. Im Bannkreis des Systems ist das Neue, der Fortschritt, Altem gleich als immer neues Unheil. Das Neue erkennen bedeutet nicht ihm und der Bewegtheit sich einschmiegen sondern ihrer Starrheit widerstehen, den Marsch der welthistorischen Bataillone als Treten auf der Stelle erraten [...]. Das Neueste gerade, und es allein stets, ist der alte Schrecken, der Mythos, der eben in jenem blinden Fortgang der Zeit besteht, der sich in sich zurücknimmt [...]. Nur wer das Neueste als Gleiches erkennt, dient dem, was verschieden wäre.“ (14) Und eben dieser höchst unbeliebte statische Aspekt von Geschichte ist der unvermindert aktuelle: weil sich nämlich die „Bedingungen“ materialistischer Gesellschaftskritik in ihren grundlegenden Determinanten seit Beginn des 20. Jahrhunderts gerade nicht grundlegend „geändert“ haben, sondern in beängstigender Weise gleichgeblieben sind. Anhaltend müssen wir mit dem Widerspruch leben, dass der Liberalismus und das ihn repräsentierende bürgerliche Subjekt unwiederbringlich vorbei sind, ohne dass deshalb die kapitalistische Vergesellschaftung in ein wirklich neues Stadium eingetreten wäre, vielmehr permanent zerfällt und ihr krisenhaftes Zerfallen entweder abwehrt oder aber sich im krisenhaften Zerfallen einrichtet und dadurch, wie in Auschwitz geschehen, ihre barbarischen Potentiale voll entfalten kann – und damit tatsächlich ein neues Stadium erreichte, das der kapitalentsprungenen Barbarei; dass aber auch dieser Zerfallsprozess nichts Schicksalhaftes und deshalb wiederum nicht ohne Hoffnung ist. Dass die warenproduzierende bürgerliche Gesellschaft bis zur Unkenntlichkeit ausgehöhlt ist, ohne darüber aber wirklich vergehen zu können, ist die anhaltende Signatur der Epoche: ein Zustand objektiven Widersinns, der nun schon ziemlich lange andauert und zugleich etwas im Ganzen Lähmendes wie im Einzelnen Unberechenbares an sich trägt. Vom Bewusstsein ist dieser eklatante Widerspruch, ja Widersinn, nicht zu schlichten oder zu versöhnen, sondern ungeschmälert darzustellen, um ihn zu übersteigen.
Auf die unmittelbare Gegenwart bezogen heißt dies, dass die „verwaltete Welt“, in der mit Blick auf Deutschland die nazifaschistische kollektive Mobilmachung in die Latenz abgedrängt war und deren Erbe in rechtsstaatlichen Formen weiterbewirtschaftet wurde, zwar ihren Verwaltungsmodus ändert und den Verwaltungsträger auswechselt, aber den verwaltenden Zugriff auf die ihr Unterworfenen im selben Maße ausdehnt, in dem sie ihn zurücknimmt.
Statt als Objekte der Versorgung durch das volksstaatlich gezähmte Kapital bzw. den bürokratischen Volkstaat werden die einzelnen Individuen wie in einer schlechten Karikatur des Liberalismus von einst als Subjekte ins Visier genommen, die ihren Objektstatus nun ganz selbstbestimmt und eigenverantwortlich verwalten dürfen. Was die Soziologen als „Individualisierung“ bzw. „Ausdifferenzierung“ der Gesellschaft und damit als Befreiung von „Bevormundung“ durch den autoritären Staat abfeiern, ist ihrem Wesen nach gerade die Vollendung von dessen „institutioneller Strategie“ (Agnoli); was bislang der Staat für die ihm Subordinierten besorgte: die Verschränkung von kapitaler Akkumulation und Daseinsvorsorge, wird nun einem jeden Einzelnen unmittelbar aufgebürdet, in die Form freier Willensentscheidung gefasst und damit privatisiert. Dadurch aber wird die private Entscheidung unmittelbar zu einer öffentlichen Angelegenheit, mithin einer „existentiellen Wertordnung“ erklärt und die Unterscheidung von Privatperson und öffentlicher Funktion systematisch untergraben: in der beliebten Mobilmachungsparole vom „Engagement“, das von jedem Einzelnen erwartet wird, ist die Einschmelzung beider Momente bereits ratifiziert.
Die gegenwärtige Gestalt von Herrschaft ist demnach der von Staats wegen verhängte Zwang zur Entscheidung, die eigene Unterwerfung in allen Lebenslagen und allen Lebensäußerungen permanent zu vollstrecken. Auf diese Weise kehrt die allgemeine Mobilisierung wieder als „freie“, auf je eigene Faust und in Konkurrenz zueinander betriebene Mobilmachung jedes Einzelnen an sich und mit sich selbst. Die „verwaltete Welt“ als die sistierte Mobilmachung geht aus eigener Logik nun in die „mobilisierte Welt“ über, das demokratisierte völkische Generalracket zerfällt in seine Unterabteilungen, die in sich und untereinander erbittert darum konkurrieren, als outgesourcte und fortan auf eigene Rechnung agierende Cliquen und Rackets als Partikel von Herrschaft, als Momente des in die Gesellschaft diffundierenden Staates anerkannt zu werden. Die Basis dieser Rackets und zugleich die elementare Form, in der sie auftreten können, ist das ebenfalls in sich zerfallende, aktuell oder virtuell überflüssige nachbürgerliche Subjekt, das sich, in Notstandsbereitschaft auf die Welt projizierend, als unmittelbare Allgemeinheit, als Souverän imaginiert, und auf der Suche ist nach Systemen, die seine haltlosen und damit tendenziell wahnhaften Privatmeinungen bestätigen und Einrichtungen, in denen es seinen Wahn mit anderen ausleben kann.
Adornos Einfalt
Horkheimers und Adornos Bemerkung „Das Existieren im Spätkapitalismus ist ein dauernder Initiationsritus. Jeder muss zeigen, dass er sich ohne Rest mit der Macht identifiziert, von der er geschlagen wird“ (15) passt nahtlos auf Verhältnisse, in der die coram publico vollzogene fortwährende Selbstzurichtung, als „lebenslanges Lernen“ nur schwach, weil mit allzu deutlichem Anklang an den Strafvollzug ideologisiert, zum Selbstzweck erhoben wird und dann, wenn sie ihren Zweck doch einmal erreichen sollte, im Job nicht mehr ihr Ziel findet, in dem sie zur Ruhe kommt oder wenigstens gelockert wird, sondern erst recht und ohne Aussicht auf ein Ende weitergeht: Was einmal die Belegschaft war, ist heute das Team, aus der Despotie der Fabrik wurde die Demokratie des Büros, in der jeder nur unter Aufsicht aller anderen und auf jederzeit widerrufbare Bewährung sein Dasein fristet und die so nahtlos in die Freizeit übergeht, dass darüber die Begriffe Arbeit und Freizeit selber sinnlos werden. Als zunehmend selbstzweckhafte Übung wiederum gravitiert die lebenslange Selbstzurichtung des Einzelnen für die Belange von Staat und Kapital zu dem, was das politische Engagement unter den herrschenden Bedingungen immer schon war: zur Pseudoaktivität, zum Spektakel bzw. Selbstdarstellungstheater. Was früher nur prekäre Künstlerexistenzen am Rande der Gesellschaft auszeichnete, wird verallgemeinert und die prosaische Selbstdressur des kapitalisierten Subjekts nimmt Bestimmungen der Kunst in sich auf, die wiederum den ordinären Zwangshandlungen unverdienten Glanz verleihen: Auf diese Weise avanciert der fröhliche Vollzug des ungelebten Lebens wahlweise zur „Lebenskunst“ oder zum „Event“, also selber zu einem künstlerischen Akt. Dies ist der harte ökonomische Kern jener allgegenwärtigen und institutionell abgesicherten Kulturalisierung aller Lebensäußerungen und Lebensbereiche.
Umgekehrt regrediert die künstlerische Produktion vielerorts entweder auf schnödes Kunstgewerbe oder gleicht sich, soweit sie sich als „engagiert“ begreift, den politischen Ersatzhandlungen an und macht sich auf diese Weise vom ökonomisch-gesellschaftlichen Alltag umso schwerer unterscheidbar, je lauter sie mit infantilen Aktionen gegen ihn mobilisiert. Gerade in den kunstbetrieblichen Rackets kommt der nachbürgerliche Sozialcharakter, der seine Ohnmacht kurzerhand in grenzenlose Allmacht ummünzt und die ihn umgebende Welt nur noch als gleichgültiges Material seines aus Panik geborenen identitären Wahns betrachtet, zum unverstellten Ausdruck und bewusstlosen Selbstbewusstsein in Gestalt der in diesen Kreisen besonders beliebten sogenannten Postmoderne: jenem irren Traum, die eigene leibliche Natur und die äußere, überhaupt alles, was an eine dem Subjekt nicht restlos kommensurable Objektwelt erinnern könnte, restlos zu unterwerfen, zu funktionalisieren und nach Möglichkeit ganz zum Verschwinden zu bringen in jener übergreifenden Seinsmacht, die nun feinsinnig „Diskurs“ genannt wird; und wie schon bei der Heideggerschen Seinsmythologie ist der darin aufscheinende „Objektivismus“ nichts anderes als ein wildgewordener Subjektivismus: ein privates, subjektives Dekret, das sich zum objektiv-allgemeinen Weltsystem aufspreizt. Weil diesen Sozialcharakter nichts ärger beleidigt als alles, was womöglich nicht in seinen ebenso leeren wie totalitären Diskursparolen aufgehen und ihn an die Armseligkeit seiner Existenz gemahnen könnte, müssen dessen Exponenten zwanghaft und immer wieder die zweckfreie – die autonome wie die unterhaltende – Kunst exorzieren bzw. sie als gutbezahlte Intendanten, Regisseure und Kulturvermittler zwanghaft kaputtschlagen. Die sogenannte Kunst, die sie dann selber feilbieten, ist dann auch entsprechend: streng organisierte Phantasielosigkeit, die ewiggleichen „performativen Akte“, in denen der schon vergessen geglaubte Aktions-, Phrasen- und Kunstgewerbemüll aus 40 Jahren linker Bewegung postmodern recycelt wird, ödeste, weil gegenstandslose Selbstbespiegelung, ein großes, gähnendes, zum Existential aufgeblähtes Nichts.Dass auf derartigen Veranstaltungen, auf denen verhinderte, vom Selbsthass umgetriebene Bürger ihren rituellen Selbstmord probehalber inszenieren, manche ihrer Protagonisten mit der Duldung oder unter dem Beifall aller Anwesenden auch noch gerne die Juden und ihren Staat symbolisch mit in den Abgrund reißen würden, erübrigt sich eigentlich angemerkt zu werden.
Die Nichtigkeit dieses postmodern legitimierten Kunstgewerbes zu demonstrieren, wäre eine der vornehmsten Aufgaben einer materialistischen Kritik, die man nicht mit der heroischen Geste des Entlarvers zu vollführen hätte – denn zu entlarven gibt es bei dem allerorten offen bekundeten Blödsinn nichts mehr –, sondern gleichsam nebenher, mit leichter Hand und einer ordentlichen Portion an Ennui und Dégoût; Haltungen, in denen zum Ausdruck käme, dass das kritische Wegschaffen jener ungustiösen Phänomene, die die „zur Identität gezwungene Welt“ (Gerhard Scheit) für uns bereithält, nur ein Mittel ist, um der Sache selbst, wie sie jenseits des Identitätszwanges wäre, geistig und vielleicht einmal auch praktisch innezuwerden – wie umgekehrt das unvermittelte „Anspringen“ auf eine Sache und die Bereitschaft, diesen individuell-idiosynkratischen Impuls nicht narzisstischerweise als persönliches Charaktermerkmal zu beschlagnahmen, sondern als von der Sache ausgehende Nötigung zu reflektieren, wiederum die Voraussetzung dafür ist, in Kritik und Polemik die einstweilen geistige Sabotage jener verhärteten Vermittlungsformen zu betreiben, die alles, was existiert, zur Identität zusammenzwingen. (16) Die an Adorno immer wieder zurecht gerühmte Großzügigkeit und Weite seines Denkens verdankt sich, was immer wieder gerne vergessen wird, einer geradezu stupenden Einfalt: einer Haltung, die sich die Naivität, die Unmittelbarkeit zur Sache nicht abmarkten lässt; einer Treue zu Erfahrungen emphatischen Charakters, wie sie vielleicht das Kind zum Staunen gebracht haben, von denen man sich einmal schutzlos hat ergreifen lassen und die man als Erwachsener verwandelnd umkreist. Deshalb konnte Adorno sagen, dass „das, was man im Leben realisiert, wenig anderes ist als der Versuch, die Kindheit verwandelnd einzuholen.“ (17) Nur wer einfältig auf eine, auf seine Sache setzt und, indem er sie reflektierend umkreist, sich von ihr mit einer Haltung der „Unbeirrtheit im Dunklen“ (18) ins Unabsehbare entführen lässt, dem wird Erkenntnis zu einem Abenteuer; und in solcher Objektivität ist unbeirrte Erkenntnis der bestimmteste Gegensatz zur Verwandlung aller Dinge in qualitätsloses Material subjektiver Zurichtung. Und der theoretischen Reflexion würde damit ein Moment des Spielerischen zurückgewonnen werden, auf das Adorno verwies, als er meinte, Philosophie sei „das Allerernsteste, aber so ernst wieder auch nicht.“ (19)
Clemens Nachtmann (Bahamas 68 / 2014)
Anmerkungen:
- http:/kritischetheorie.org/die-konferenz/; alle im Text zitierten Passagen aus den Ankündigungstexten zur Konferenz sind hier zu finden.
- Zu diesem Sozialcharakter ausführlicher: Clemens Nachtmann: Krisenbewältigung ohne Ende, sowie Die demokratisierte Volksgemeinschaft als Karneval der Kulturen in: Stephan Grigat: Postnazismus revisited, Freiburg 2012, 149 ff. bzw. 47 ff.
- Frank Böckelmann: Begriffe versenken, Bodenheim 1996, 180 ff.
- „Keine Angst vor dem Elfenbeinturm“. Ein Spiegel-Gespräch , in: T. W. Adorno: Gesammelte Schriften, Band 20.1, Frankfurt a. M. 1997, 403
- Oscar Wilde: Die Seele des Menschen unterm Sozialismus, in: ders.: Werke in 5 Bänden, Zürich 1999, Band 4, 274
- Die Unmittelbarkeit solcher Erfahrungen, ihr intuitives Moment, ist nicht das abstrakte Gegenprinzip zu Vermittlung und Rationalität, sondern in ihr „explodiert das unbewusste, den Kontrollmechanismen nicht ganz botmäßige Wissen und durchschlägt die Mauer der konventionalisierten und ‚realitätsgerechten‘ Urteile.“ (T. W. Adorno: Zur Metakritik der Erkenntnistheorie, Frankfurt a. M. 1970,; Intuitionen sind also ihrerseits durch sedimentiertes Wissen kategorial vermittelt, das sie aber, indem sie sich dem Subjekt als jähe, überfallartige, nicht kommandierbare, „ichfremde“ Einfälle geltend machen, zugleich durchbrechen.
- Das „prekäre Glück indessen ist in der exponierten neuen Musik so gegenwärtig wie die Verzweiflung [...]. Jene dissonanten Akkorde, an denen einmal die Wut des dem Unheil verschworenen Normalbewusstseins entflammte [...], waren Träger des Ausdrucks nicht nur von Schmerz sondern auch von Lust [...]. Die vieltönigen Klänge tun nicht nur weh, sondern waren in ihrer schneidenden Gebrochenheit immer auch schön. Die Schwelle, die den avancierten Künstler vom Muff des Heilen scheidet, ist [...] dass er sich dieser Schönheit ohne Reservat überantwortet.“ (T. W. Adorno: Kriterien der neuen Musik, in: ders. Gesammelte Schriften, Band 16, Frankfurt a. M. 1997,
- T. W. Adorno: Philosophische Terminologie, Frankfurt a. M. 1973, 83
- „...die singulären und versprengten Elemente der Frage so lange in verschiedene Anordnungen [zu bringen], bis sie zur Figur zusammenschießen, aus der die Lösung hervorspringt, während die Frage verschwindet“ – so bestimmt Adorno bereits 1931 die Aufgabe materialistischer Erkenntnis (T. W. Adorno: Die Aktualität der Philosophie, in: ders., Gesammelte Schriften, Band 1, Frankfurt a. M. 1997,.
- Dazu: T. W. Adorno: Anmerkungen zum philosophischen Denken, in: ders., Gesammelte Schriften, Band 10.2., Frankfurt a.M. 1997, 600 ff. Über dieses „passivische Moment aller Kritik“ hat Magnus Klaue einen kenntnisreichen und wohlformulierten Aufsatz veröffentlicht (Fremdbestimmungen, in: Bahamas Nr. 64, 66 ff.).
- Diskussionsprotokolle zur Dialektik der Aufklärung, in: Max Horkheimer: Gesammelte Schriften, Band 12, Frankfurt a. M. 1986, 520 f.
- T. W. Adorno: Negative Dialektik, Frankfurt a. M. 1966, 197
- In der Fähigkeit, in der Erfahrung von Ohnmacht seiner selbst mächtig zu bleiben, ist die „Rettung“ des bürgerlichen Individuums vorhanden – als ein Moment und mit der verwandelten Intention, die identifizierenden Leistungen des Subjekts selbstkritisch dem Nicht-Identischen zuzuwenden; und das ist, wenn man so will, die basale Intention des Adornoschen Philosophierens: eine „Achsendrehung der Kopernikanischen Wendung“ zu vollführen, mit dem Begriff gegen den Begriff bzw. mit dem Subjekt gegen es zu denken.
- T. W. Adorno: Reflexionen zur Klassentheorie, in: ders.: Gesammelte Schriften, Band 8 (=Soziologische Schriften I), Frankfurt a. M. 1996, 374 ff. Walter Benjamin hat, eines Sinnes mit Adorno, diesen Sachverhalt auf die Formulierung gebracht: „Der Begriff des Fortschritts ist in der Idee der Katastrophe zu fundieren. Dass es ‚so weiter‘ geht, ist die Katastrophe. Die Katastrophe ist nicht das jeweils Bevorstehende, sondern das jeweils Gegebene.“ (Walter Benjamin: Illuminationen. Ausgewählte Schriften 1, Frankfurt a. M. 1977,
- T. W. Adorno/Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung, Frankfurt a. M. 1971, 138
- Wobei auch diese Sabotage ein „passivisches Moment“ aufwiese: Denn Herrschaft, die das Individuum als Subjekt in Form allseitiger Mobilisierung total beschlagnahmt, ist zugleich in es abgesunken und erreicht damit einen Schwellenwert, indem sie es permanent konstitutionell überfordert; keine allzu verwegene Hoffnung ist es daher, dass sie am „Ennui und Dégoût“, d. h. an der Lustlosigkeit und Erschöpfung der Zwangsmobilisierten zugrundegehen könnte. Vgl. dazu auch Uli Krug: Bereitschaft zu allem, in: Bahamas Nr. 64, 30 ff.
- Auf die Frage: Warum sind Sie zurückgekehrt, in: T. W. Adorno: Gesammelte Schriften, Band 20.1, Frankfurt a. M. 1997, 395
- T. W. Adorno: Form in der neuen Musik, in: ders.: Gesammelte Schriften, Band 16, Frankfurt a. M. 1997, 626
- Adorno: Negative Dialektik, a.a.O., 26
SPALTE3-AKTUELL-RUBRIK
Frühere Aktivitäten sind im Aktuell-Archiv aufgeführt. Dort gibt es auch einige Audio-Aufnahmen.
Alle bisher erschienenen Ausgaben der Bahamas finden Sie im Heft-Archiv jeweils mit Inhaltsverzeichnis, Editorial und drei online lesbaren Artikeln.