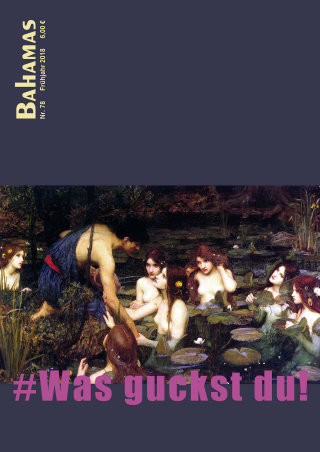Das Erbe des roten Oktober
Überlegungen zum Verhältnis von Lenin, Stalin und Putin
Überall in der westlichen Welt gedachte man im vergangenen Herbst des hundertjährigen Jubiläums der Oktoberrevolution: meist mit einer Art ruhigen Interesses, so wie es das Feuilleton gerne mit historischen Ereignissen hält, die ihre Brisanz längst verloren haben und doch immer noch ein wohliges Schaudern hervorzurufen vermögen. Planwirtschaft, Enteignung und Kollektivierung scheinen den Geschöpfen der postmodernen Gesellschaft mit ihrer umfassenden Privatisierung von Risiko und Abstieg so fern wie ein anderer Planet. Dass verbliebene linke Sekten trotzdem vergeblich versuchten, Imagegewinn aus dem Jubiläum zu schlagen, wie die MLPD, die im Bundestagswahlkampf mit Lenin-Plakaten antrat, fällt da kaum ins Gewicht; ebenso wenig wie mancherlei Bemühungen, das historische Ereignis durch sinnwidrige Erzählweise dem identitätsfixierten jüngeren Politpublikum schmackhaft zu machen. (1) Auf dessen Aufmerksamkeit konnten schon gar nicht die diversen Grüppchen anarchistischer oder trotzkistischer Provenienz rechnen, die sich zum Jubiläum wie stets daran versuchten, den Zeitpunkt des Scheiterns der Revolution (von Kronstadt bis Trotzkis Ausweisung) festzulegen beziehungsweise Gründe für das Ausbleiben einer „dritten Revolution“ (nach der ersten vom Februar und der zweiten vom Oktober 1917) zu finden. Aber immerhin war die Oktoberrevolution als solche ein Topthema für Symposien, ein Pflichtpunkt in den Verlagsprogrammen und willkommener Veranstaltungsanlass für Buchläden und Kulturzentren.
Im Land der Revolution selber verhielt es sich ganz anders. Zwar wird dort schon seit längerem wieder eine positive Haltung zur untergegangenen Sowjetunion gefördert, wobei man darüber hinwegsieht, dass deren Gründung selbst auf eine Revolution zurückging. So ordnete Putin beispielsweise 2015 die Schaffung einer nationalen Schülerorganisation an, die sich ganz offen der Fortsetzung des Komsomolzen- und Pionierwesens verschreibt; der damalige Bildungsminister Liwanow sprach bei dieser Gelegenheit davon, wie schön es sei, „dass wir doch alle Oktoberkinder sind“. (Spiegel online, 29.10.2015) Doch was es mit diesem Oktober auf sich hat, genauer gesagt: mit dem 25. Oktober 1917 nach altrussisch-julianischem Kalender, darüber erfahren russische Kinder in der Schule und auch im Fernsehen so gut wie nichts. Die neue russische Gedenkpolitik an den Jahrestag des Umsturzes in Petrograd, der sich damals im Hof und in den Fluren des Winterpalastes abgespielt hatte, lehrt, dass an diesem Tag eigentlich nichts besonders Erinnernswertes geschehen sei; abgesehen davon, dass die „Zerstörung von Staatlichkeit“, wie Putin selbst die Oktoberrevolution charakterisierte, einem Autokraten nicht gefallen kann, der gerade auf seine Weise versucht, in der Ukraine einen Umsturz einzudämmen.
Der russische Sonderweg
Offizielle Gedenkfeiern an den „roten Oktober“ gab es jedenfalls in Russland keine, das Jubiläum fiel schlicht unter den Tisch. Zarenreich und Sowjetunion hingegen werden offiziell gleichermaßen geschätzt, Lenin und Stalin reihen sich bruchlos in die verehrte Reihe großer Zaren ein, die von Iwan dem Schrecklichen über Peter den Großen bis zum Napoleon-Besieger Alexander II. reicht. Deshalb denkt auch niemand mehr daran, den Lenin-Kult auszusetzen oder wenigstens das groteske Mausoleum am Kreml endgültig zu schließen. Aber vielleicht steckt in der affirmativ gemeinten Geschichtslüge des Putin-Regimes auf ganz eigene Weise sogar mehr als nur ein Körnchen unangenehmer Wahrheit, erfasst die Betonung der Kontinuität russischer Geschichte über den Oktober hinweg doch mehr, als es selbst begreifen kann und vor allem will. Die Verehrung sowjetischer Größe jedenfalls ist dem Regime nicht gefährlich, obwohl zuerst Jelzin und später Putin in den 1990er Jahren so ziemlich alles an sowjetischen Errungenschaften zerstört haben und verantwortlich zeichnen für den Zusammenbruch der Systeme sozialer Sicherheit und gesundheitlicher Vorsorge. Sie und die mit ihnen verbundenen Sippschaften aus der Nomenklatura hatten brachial jene geschichtliche Anomalie beseitigt, die Isaac Deutscher 1967 zum 50. Jubiläum der Oktoberrevolution als Bedingung dafür angesehen hatte, weiterhin sozialistische Hoffnung in die Sowjetunion zu setzen: dass nämlich die herrschende Klasse dort immerhin kein Eigentum an den Produktionsmitteln besitze. (2) Diese Produktionsmittel, die sich im postsowjetischen Russland in erster Linie auf die Extraktion von Bodenschätzen und die Rüstungsindustrie beschränken, sind binnen weniger Jahre unter den Satrapen aufgeteilt worden. Die Massen hingegen speist man mit der Propagierung russischer Größe ab, damit, Teil einer historischen Sendung zu sein, die der westlichen Dekadenz und Schwächlichkeit – nicht umsonst ist es im heutigen Russland gang und gäbe, Europa als „Gayropa“ zu bezeichnen – eine robuste, fest im Boden der Tradition wurzelnde Gemeinschaft entgegensetzt.
Dass diese Abspeisung so reibungslos funktioniert, dass die große Mehrheit lieber eine dramatische Abnahme der durchschnittlichen Lebenserwartung hinnimmt, wie in den letzten 25 Jahren geschehen, als sich in ihrem Stolz kränken zu lassen, weckt Zweifel daran, ob ungeachtet aller Bürgerkriegsgemetzel überhaupt eine Revolution stattgefunden hat, die tatsächlich soziale und mentale Strukturen grundstürzend geändert hätte – und deren an sich gute und richtige Mission dementsprechend überhaupt hätte verraten werden können, gleich ob man diesen Verrat nun auf die Niederschlagung des Kronstädter Aufstands datiert oder auf die Ausschaltung der linken Opposition, die Ausbootung Trotzkis, die Moskauer Prozesse oder – von der anderen, der stalinistischen Seite betrachtet – auf den „Verrat“ Chruschtschows am Erbe des großen Führers des Vaterlandes und das Renegatentum von Chruschtschows Nachfolgern. Dass Linke diesen sehr unterschiedlichen Verratstheorien so vehement anhängen, mag damit zu tun haben, dass die Oktoberrevolution, die Blaupause aller späteren „fortschrittlichen“ Machtübernahmen in Ländern der kapitalen Peripherie, die phantastische Möglichkeit barg, eine Handvoll entschlossener Revolutionäre im Handstreich an die Spitze des Staates zu bringen, wie es der feuchte Traum ökonomisch überflüssiger Intellektueller seit jeher ist.
Dabei scheint sich die Oktoberrevolution – sowohl was die Intention der Revolutionäre als auch ihren Verlauf und historisches Resultat angeht – besser in den russischen Sonderweg in die Neuzeit und die Moderne zu fügen, als es einem Revolutionär lieb sein kann. Sie war kein Ausbruch aus der Geschichte Russlands, sondern schlug lediglich ein neues Kapitel der Geschichte dieses Sonderwegs auf. Und das mit einer gewissen historischen Zwangsläufigkeit, mit der sich die Diktatur der Bolschewiki in die Geschichte aller autoritären Modernisierungsversuche Russlands einreiht: von denen Peters des Großen im 18. Jahrhundert bis zu jenem Putins, der die formierte Gesellschaft ohne soziales Zugeständnis lenkt und die Aufrüstung ohne konkurrenzfähige Industrie betreibt. Denn der Bolschewismus tendierte nicht allein wegen der äußeren Bedrohungen nach der Machtübernahme dazu, zum Monstrum zu degenerieren, sondern auch, weil er in seinem theoretischen wie praktischen Kern all die Beschränkt- und Besessenheiten der volkstümelnd-nihilistischen Opposition der Zarenzeit fortführte, während seine geistige Bindung an den zeitgenössischen Marxismus eher locker war. Dass sich der Bolschewismus so gut in den russischen Sonderweg fügte, mag auch die Macht- und Aussichtslosigkeit sämtlicher linken Opposition im Apparat erklären; denn diese hatte ebenso wenig gesellschaftliche Grundlage im nachrevolutionären Russland wie die westlich orientierte sozialdemokratische oder liberale Opposition im zaristischen Russland. Eine solche Grundlage hätte eine Revolution im Russland erst schaffen müssen – und dazu wäre die des Februar 1917 wohl bei aller nur kriminell zu nennenden Unzulänglichkeit der provisorischen Regierung geeigneter gewesen als die des Oktober.
Bei derart häretischen Überlegungen zur Oktoberrevolution und dazu, wie sehr Putins Russland sie beerbt, kommt man nicht umhin, weit zurückzugehen und die Genese des eigentümlichen Verhältnisses Russlands zu Westeuropa zu beleuchten, das schmerzliche Erfahrungen gesellschaftlichen Rückstandes auf charakteristische Weise durch moralisches und letztlich militärisches Sendungsbewusstsein kompensiert. Russland gehört zwar von Beginn an zu den christlichen Nationen, der Glaube spielte eine bedeutende Rolle bei Formierung und Aufstieg des Landes. Nur war es ein ganz anderer Glaube, eine andere Art Christentum als jenes, das im Westen vorherrschte, das letztlich die Vorstellung eines allgemeinen, gleichen Rechts für alle hervorbrachte und so schließlich an seine eigenen Grundlagen rührte. Schon seit Augustinus’ Zeiten verweigerte sich die Orthodoxie seiner Lehre, der Trennung von weltlicher und geistlicher Herrschaft, was Augustinus als Konsequenz des Sich-Einrichtens in der Welt bei ausbleibender Parusie betrachtet hatte. Statt zu versuchen, gesellschaftliches Unheil, das nicht mehr gelindert wird durch die baldige Heilserwartung, in erträgliche Bahnen zu lenken, Herrschaft durch Recht zu beschränken, lebte in der östlichen Kirche ein archaischer christlicher Absolutismus fort. Er manifestierte sich in absoluter, losgelöster Herrschaft von Kaiser und Klerus über ihre Leibeigenen und erstickte nahezu jeden Funken Aufklärung mit irrationaler Spiritualität: Brutale Herrschaft und eschatologische Entrückung stimmten im Verzicht auf Mäßigung und Abstraktifizierung von göttlicher wie weltlicher Macht überein.
So etwas wie die Renaissance im westlichen Europa hat sich dementsprechend in Russland nie ereignet; während in Westeuropa die Städte selbständig wurden, brandschatzte Iwan der Schreckliche die Hauptstadt Nowgorod, in der ein erstes Pflänzchen bürgerlicher Partizipation, die sogenannte „Wetsche“, eine Art Ratsversammlung, gediehen war; der Autokratismus setzte sich durch, indem er alle frühbürgerlichen Impulse sofort erstickte. Die Ausrufung Moskaus als russische Hauptstadt ging einher mit ihrer Proklamation als „drittes Rom“, also als Wiedergänger des antiken Byzanz, in dem irdische Allmacht und göttliche Vorsehung, Kaiser und Klerus sich zu einem Zeitpunkt identisch setzten, als deren immerhin bereits rechtlich vermittelte Einheit auch in Mitteleuropa zu zerbrechen begann. Selbständige Städte fehlten in Russland ebenso wie eine entwickelte gesellschaftliche Spezialisierung und Arbeitsteilung, deren Indikator in Europa seit der ersten Jahrtausendwende nach Christi die Einrichtung von Universitäten war: Russland erhielt seine erste (!) Universität 1755 in Moskau im Zuge der Peterschen Reformen und musste auf seine zweite bis ins 19. Jahrhundert warten.
Die Gesellschaft sah noch im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entsprechend aus: Zwar war die Leibeigenschaft 1861 abgeschafft worden, am ländlichen Leben der ebenso abergläubischen wie analphabetischen Bauern änderte sich aber nicht viel. Sie blieben eingespannt ins hergebrachte Kollektivsystem der Obschtschina und des Mir, das jede Individualisierung verhinderte; es verursachte die periodischen Hungersnöte ebenso sehr, wie es sie durch Solidarabgaben milderte und den Bauern die bittere Genugtuung gab, dass alle ihresgleichen ebenfalls hungern mussten. Und als die Stolypin’schen Reformen in den Jahren bis zum Ersten Weltkrieg das im Gewaltstreich nachholen wollten, was in Westeuropa vor Jahrhunderten begonnen hatte – die Privatisierung von Grund und Boden und in Konsequenz die Verstädterung der Bevölkerung –, machte sich das Fehlen urbaner Strukturen ebenso bitter bemerkbar wie die ungebrochene geistfeindliche Tradition der Orthodoxie, die zur Volksbildung – anders als die katholische Kirche – weniger als nichts beigetragen hatte.
Russische Opposition
Verzweiflung, Ohnmacht und Dummheit der ländlichen Massen auf der einen Seite und eine durch hybrides Sendungsbewusstsein kompensierte Rückständigkeitsscham der westlich orientierten Aristokratie auf der anderen Seite waren die Triebkräfte, die einer Art neuen orthodoxen Mönchsordens Gestalt und Wirkung verliehen, der sogenannten Intelligenzia. Kaum jemand beschreibt deren Vorstellungswelt so genau, wie es auf durchaus unfreiwillig abstoßende Weise Nikolai Tschernyschewskis Roman Was tun (1863) gelang – zugleich übrigens Lenins Lieblingsschmöker: Dessen Held Rachmetow ist ein asketischer Übermensch, ganz in der Tradition des heiligen Narren, der die Welt aus den Angeln heben möchte, ohne sie überhaupt be- und ergriffen zu haben, geschweige denn von ihr ergriffen worden zu sein. Die Vorstellung, dass in der ebenso archaischen wie barbarischen Blutsurenge des russischen Dorfs bereits potentiell der Sozialismus herrsche, prägte den volkstümelnden Teil der radikalen russischen Opposition zutiefst, deren fraktionsübergreifende Schrecklichkeit Dostojewskis Roman Die Dämonen unbestechlich vorgeführt hat. Die Ideen der Volkstümler Netschajew oder Tkatschow, um zwei der bekanntesten vorbolschewistischen Revolutionäre zu nennen, scheinen im Lichte der späteren Entwicklungen des Jahres 1917 und erst recht der Kollektivierungsphase 1929–1933 unter Stalin dem Bolschewismus wesensverwandter als irgendetwas, das sich in den Blauen Bänden finden lässt. Nebenbei ist es nicht übermäßig zynisch, wenn man sich in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass unter Stalin die in Sowchosen oder Kolchosen, den ländlichen Produktionskollektiven, Beschäftigten in gewisser Weise genauso an der Scholle klebten wie kurz zuvor noch die Leibeigenen, denn sie durften ihr Gebiet und die landwirtschaftliche Tätigkeit nicht ohne Erlaubnis der Partei verlassen oder aufgeben.
Das Fehlen bürgerlicher Strukturen sei in Wahrheit Russlands Stärke, hieß es hingegen in der Opposition; eine zu allem entschlossene Avantgarde könne durch Zerschlagung des Zarismus unmittelbar die ländliche russische Gemeinwirtschaft in den Sozialismus überführen (was Rudi Dutschke noch 1975 in seinem Versuch, Lenin auf die Füße zu stellen wieder aufwärmte). Der Einwand des Gründervaters der russischen Sozialdemokratie, Georgi Plechanow, dass der Sozialismus eine bürgerliche Gesellschaft zur Grundlage haben müsse, um tatsächlich einen Fortschritt darzustellen, verhallte letztendlich; und das spätestens, als Lenins Aushilfskonstruktion, die dem Oktoberputsch geschichtsphilosophische Legitimität verleihen sollte, sich als so hinfällig erwies, wie sie von Anfang an war. Lenin hatte argumentiert, dass die westeuropäischen Länder, allen voran das von ihm zutiefst bewunderte Deutschland, einmal vom russischen Fanal angesteckt, ebenfalls baldigst zum Sozialismus voranschreiten und Russlands ökonomisch-technische Rückständigkeit kompensieren helfen würden, während man in Russland dem Sozialismus (wohlgemerkt jenem, der nach Lenins Wort der deutschen Reichspost innewohnte) mit den Methoden von Zar Peter den Weg ebnete. (3)
Diese Konstruktion war nicht allein der verzweifelten Lage Russlands am Ende des Ersten Weltkriegs geschuldet. Dass sich der Leninismus schon zu Lebzeiten seines Namensgebers kanonisierte, ist wohl viel mehr noch der Tatsache geschuldet, dass er eine Scheinsynthese von westlichem Denken und russischer Berufung anbot. Die Vorstellung einer historischen Mission des „russischen Menschen“, die heute die Propaganda Putin-Russlands prägt, ist so alt wie das Modernisierungsdilemma Russlands, in dessen Gefolge nationale Kränkung und Hybris immer neue Verbindungen eingegangen sind, die zur geistigen Vorgeschichte des Stalin’schen „Sozialismus in einem Land“ gehören. Ein typisches Beispiel bildet Dostojewskis in Russland Furore machende Rede zur Enthüllung des Puschkin-Denkmals am 8. Juni 1880 in Moskau, die sogenannte Puschkin-Rede. Dostojewski erkannte darin durchaus den historisch rückständigen Charakter der russischen Gesellschaft, sah genau darin aber auch eine Berufung, einen geschichtsmetaphysischen Seelenadel: Der „Westler“, wie im damaligen Russland reformorientierte und gebildete Russen genannt wurden, ist Dostojewski zufolge der Träger eines „Allmenschentums“, in dem sich die Gegensätze zwischen westlichem Fortschritt und russischer Seelentiefe aufhöben: „Die Bestimmung des russischen Menschen ist eine universale […]. Mag unser Land arm sein, aber dieses arme Land ‚durchwandert Christus in Bettlergestalt‘. Ja, warum sollten wir nicht trotz unserer Armut sein letztes Wort in uns tragen können? Hat nicht auch er im Stall in einer Krippe geruht?“ (4)
Das Motiv der „russischen Sendung“, die der Modernisierung eine Seele, einen Sinn einhaucht, den diese selber nicht entfalten kann; dieses Motiv, die westliche Welt vor sich selbst zu retten, sie auf den rechten Weg zu bringen, trieb letztlich wohl auch Lenins Revolutionsputschismus an, wenn auch in prosaischer Form und in durchaus kreativem Rückgriff auf eine westliche Geschichtsphilosophie, die an vorderster Front des Fortschritts zu stehen schien, den Marxismus. Lenin wies Russland mit ein paar theoretischen Kniffen eine eschatologische Rolle bei der Beendigung aller bisherigen Geschichte zu: Nach dem Muster, dass gerade die Letzten die Ersten sein werden, solle der Sozialismus nicht in den fortgeschrittenen Ländern das Licht der Welt erblicken, sondern da, wo Lenin das schwächste „Kettenglied“ des Imperialismus verortete: (5) in Russland also, einem Land, das wenige Jahre zuvor nicht einmal dem wirtschaftlichen Emporkömmling Japan kriegerisch hatte standhalten können. Indem man aber den Kapitalismus da überwand, wo er sich nie entfaltet hatte, tauchte man die kollektivistischen Traditionen des Agrarlandes nolens volens in ein neues historisches Licht. Sie sollten von einem vorkapitalistischen Hemmnis zum Sprungbrett aus der Geschichte werden und damit das von Dostojewski anvisierte Heilsgeschehen materialisieren; ein Heilsgeschehen, das in einer spezifischen Modernisierung am Ende der Geschichte, die quasi die Neuzeit und ihre Zivilisierungsgeschichte überspringt – bei Lenin musste dazu noch ein Schnellkursus in deutscher Organisation absolviert werden –, bestehen sollte.
Dieses gesellschaftlich-historische Phantasma russischer Ideologie, das den geistigen Hintergrund Lenins bestimmte, erklärt wohl die eigenartige Spannung, die dessen Werk prägt. Die politischen Schriften werden von einem autoritären Putschismus dominiert, einem Voluntarismus, der im Machtergreifungsprogramm der „Aprilthesen“ von 1917 lediglich gipfelt und eher an Traditionen des von Lenin verabscheuten Anarchismus denn an die des westlichen Marxismus gemahnt. Lenins philosophisch-theoretische Schriften wie Materialismus und Empiriokritizismus (1908) sind in krassem Gegensatz dazu Musterbeispiele für vollendeten Determinismus, bei dem sich eherne geschichtliche Gesetze durchsetzen und Bewusstsein ausschließlich eine Widerspiegelung materieller Umstände darstellt; Individualität ist durchgestrichen. Lenins politischer Voluntarismus und sein sklavischer Widerspiegelungsmarxismus konvergieren nur in einem entscheidenden Punkt: in der Absehung von den Wünschen empirischer Einzelner. Der mit seinen Genossen putschende Lenin vollstreckte zugleich nur den Gang der Geschichte, den er und die Seinen nur eher begriffen hatten als die Masse der anderen. Mit dieser Haltung aber war Lenin einer sehr russischen Tradition der Unterwerfung des Gattungsexemplars unter Kollektivverbände verpflichtet, die nun sozialistisch etikettiert in Fraktionsverbot und Parteidisziplin fortlebte. Lenin variierte die Orthodoxie lediglich so, dass sich in absoluter Herrschaft jetzt nicht mehr Gottes den Menschen enthobener Wille ausdrückte, sondern die ihnen ebenso enthobenen, ehernen Gesetze des historischen Materialismus.
Endgültige Entwestlichung
Seine Konstruktion war deshalb folgenschwer, weil sie zur pauschalen Legitimation dafür einlud und genutzt wurde, dass die Bolschewiki eine Diktatur an Stelle des Proletariats errichteten. Die ersten freien Wahlen Russlands im November 1917 hatten den Bolschewiki gerade einmal knapp ein Viertel der Sitze in der Duma eingebracht. Die Kontrolle über die Waffen ermöglichte aber die Abschaffung des Mehrparteiensystems bis zum Sommer 1918; Avantgardeherrschaft und das „Halten der Kommandohöhen“, wie Lenin es bezeichnete, taten ein Übriges. Linke Einwände, sowohl gegen die barbarischen Voraussetzungen wie Mittel dieses geschichtlich ersten, aber nicht letzten „großen Sprungs nach vorne“, wie Mao später den seinen zu nennen beliebte, kanzelte Lenin in einem Ton gegenüber den „Verrätern“ ab, der sich durchaus als Vorlage für die Anklageschriften seines Nachfolgers eignete. Letztlich etablierte sich durch die Revolution ein Reformzarismus, der aus Sicht der einfachen Bevölkerung gar nicht leicht zu unterscheiden war von dem sprichwörtlich gewordenen Abschneiden der Bärte unter Zar Peter 150 Jahre vorher. Die neue Ordnung, die dabei entstand, wurde der Bevölkerung oktroyiert, und die notwendig damit einhergehende politische Passivität konterkarierte alle bildungspolitischen Anstrengungen der Bolschewiki, wobei das Lippenbekenntnis in der Zellensitzung nie so recht das nun – natürlich völlig zu Recht – verpönte religiöse Bekenntnis beim Popen ersetzen konnte.
Vor diesem Hintergrund nimmt es nicht wunder, dass die ältere Landbevölkerung noch in den 1980ern von Gorbatschow respektvoll als „dem guten Zaren“ sprach. Der Bolschewismus, der in Stalins Grundlagen des Leninismus (1924) kodifiziert worden war, passte gut in die Traditionslinien russischer Sozial- und Mentalitätsstrukturen. Er bediente slawophile Größenphantasien orthodox-christlicher Provenienz, dass nämlich die Völker der Sowjetunion, namentlich das russische, dazu ausersehen seien, der Welt, gerade auch der an sich fortgeschritteneren, das Licht zu bringen. Bei Lenin hieß es noch etwas verschämt, dass die Stärke der russischen Arbeiter, inkarniert in der Avantgarde-Partei, das Land fortschrittlicher machen werde als den Rest der Welt, auch wenn es in allen materiellen und kulturellen Belangen noch hinter dem Rest Europas hinterherhinke. (6) In Stalins berühmtem Trinkspruch an das russische Volk vom 24. Mai 1945, der die Russen als „die hervorragendste Nation unter allen zur Sowjetunion gehörenden Nationen“ pries, war es dann schon der metaphysische Volkscharakter, denn die Russen besäßen mehr als alle anderen „einen klaren Verstand, einen standhaften Charakter und Geduld“. (7)
Dass die absolute Zentralisierung der Macht an die dem Volk vertrauten Erfahrungen aus der Autokratie anknüpfte, war evident. Neu aber und damit zugleich Stalins Erfolgsrezept war, dass der einfache Russe Teil dieses Apparates werden konnte, der wiederum in seiner Propaganda das Volk pries: Die Säuberungen stärkten Stalin dadurch, dass die Liquidierung der alten westlich gebildeten Elite der Bolschewiki auf allen Ebenen Aufstiegsmöglichkeiten bot, die bislang in Russland unbekannt gewesen waren; und die Millionen Aufsteiger, deren Familien noch vor wenigen Jahren zur verachteten Basis der russischen Gesellschaft gehört hatten, eiferten ihrem Mentor und Vorbild Stalin dankbar nach. (8) Diese Russifizierung und endgültige Entwestlichung des Herrschaftsapparates in den 1930er Jahren bildete dann auch das Ferment der postsowjetischen Usurpatorenklasse. In der von der putinistischen Ideologie verabsolutierten Gegenüberstellung des gesunden russischen Menschen und des verweichlichten, wurzellosen Westlers klingen Stalins „Säuberungen“, die im Grunde die Beseitigung der „Westler“ und somit ein riesiger Personalaustausch auf allen Ebenen der Gesellschaft waren, bis heute nach.
Kollektive Rituale autoritärer Herrschaft
So sind der andauernde Lenin- und der neuerdings wieder mächtig aus der Versenkung auftauchende Stalin-Kult zwar durchaus Inszenierungen, die der ikonographischen Tradition der Orthodoxie folgen, wie eine gängige Kritik lautet. Mehr aber noch sind es kollektive Rituale autoritärer Herrschaft, die den Verzicht auf Individualrechte, Koalitionsfreiheit und Gewaltenteilung nicht nur in aktueller, sondern eben auch in historischer Perspektive feiern. In den vergangenen Jahren sind in Russland Hunderte neuer Stalin-Denkmäler errichtet worden; in einer Moskauer Metro-Station prangt seit wenigen Jahren wieder eine Lobeshymne an Stalin, den „Erzieher des Volkes“. Fast vierzig Prozent der Russen nannten in einer aktuellen Umfrage Stalin die „herausragendste Persönlichkeit aller Zeiten und Völker“, womit er den ersten Platz vor dem zweitplatzierten Putin einnahm, der sich seinerseits öffentlich die „unnötige Dämonisierung Stalins“ verbot, die im Westen betrieben werde. (NZZ, 25.10.2017)
Ein von jedem utopischen Zukunftsversprechen und sozialen Kompromiss mit den Lohnabhängigen gereinigter Autoritarismus, der umso mehr wieder mit Stalin kokettiert, als der Erlös der russischen Energieexporte sinkt, ist wohl das, was man hundert Jahre danach als Erbe des roten Oktober ansehen muss. Dieses Erbe dementiert zum einen die leninistisch-antiimperialistische Illusion, dass es ohne Zivilisation eine Revolution geben könne, die ihren Namen verdient; zum anderen konterkariert es die fixe Idee vieler autoritärer Charaktere , dass sozialer Fortschritt irgend mit Loyalität zu Russland verknüpft sei. Wenn die DKP, die zu Recht eine stärkere Besteuerung von großen Vermögen fordert, zugleich T-Shirts mit dem Konterfei Putins verkauft, ist das so absurd, wie mit Kim-Jong-un-Plakaten für atomare Abrüstung zu demonstrieren.
Uli Krug (Bahamas 78 / 2018)
Anmerkungen:
- Auf diese Weise thematisierte Bini Adamczak das Jubiläum der Oktoberrevolution. Ihr Buch Beziehungsweise Revolution – 1917, 1968 und andere (Berlin 2017) glänzt nicht nur mit höchst eigenwilliger Grammatik, sondern auch mit der These, dass Revolutionen nicht wie einst auf den Staat gerichtet sein sollten, ja nicht einmal mehr auf das Individuum; die Beziehungsarbeit solle ihr Inhalt sein.
- Vgl. Isaac Deutscher: Die unvollendete Revolution 1917–1967, Hamburg 1981, 126 f.
- Man kann Lenin nicht vorwerfen, dass er es an Deutlichkeit habe mangeln lassen. So schrieb er in seinem berühmten Pamphlet Über „linke“ Kinderei und Kleinbürgerlichkeit Anfang Mai 1918: „Die Geschichte […] nahm einen so eigenartigen Verlauf, dass sie im Jahre 1918 zwei getrennte Hälften des Sozialismus gebar […] Deutschland und Russland verkörpern 1918 am anschaulichsten die materielle Verwirklichung einerseits der ökonomischen, produktionstechnischen, sozialwirtschaftlichen Bedingungen und anderseits der politischen Bedingungen für den Sozialismus […]. Solange in Deutschland die Revolution mit ihrer ‚Geburt‘ säumt, ist es unsere Aufgabe, vom Staatskapitalismus der Deutschen zu lernen, ihn mit aller Kraft zu übernehmen, keine diktatorischen Maßnahmen zu scheuen, um diese Übernahme noch stärker zu beschleunigen, als Peter die Übernahme der westlichen Kultur durch das barbarische Russland beschleunigte, ohne dabei vor barbarischen Methoden des Kampfes gegen die Barbarei zurückzuschrecken.“ (W.I. Lenin: Ausgewählte Werke in drei Bänden, Berlin 1970, Bd.2, 791; Hervorhebungen im Original)
- Die Rede ist im Internet zugänglich: www.luebeck-kunterbunt.de/Feuilleton/Rede_auf_Puschkin.htm.
- Die später vielstrapazierte Metapher vom Kettenglied geht zurück auf Lenins Schrift Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus (Lenin Werke, Band 22, Berlin 1960, 268)
- So heißt es ebenfalls in Über „linke“ Kinderei und Kleinbürgerlichkeit: „Wir, das Proletariat Russlands, (sind) mit unserer politischen Ordnung, mit der Stärke der politischen Macht der Arbeiter England, Deutschland oder jedem beliebigen andern Land voraus, zugleich (stehen wir) aber in bezug auf die Organisation eines wohlgeordneten Staatskapitalismus, in bezug auf die Höhe der Kultur […] hinter dem rückständigsten der westeuropäischen Staaten zurück.“ (a.a.O., 796)
- Online ist die Ansprache verfügbar unter: www.1000dokumente.de/index.html/inde x.html?c=dokument_ru&dokument=0028_toa&ob ject=translation&l=de
- Auf diesen ebenso mörderischen wie umfassenden Gesellschaftsumbau in den 1930er Jahren hat vor allem Isaac Deutscher immer wieder hingewiesen, um zu erklären, wie sich Stalin an der Macht etablieren konnte. In seiner Stalin-Biographie von 1949, die, was das Verständnis des Autors vom bolschewistischen Apparat und der darin üblichen Art, zu denken und sich auszudrücken, angeht, bis heute wohl unübertroffen bleibt, analysiert Deutscher eine Generation von „Stalin’s frontier men“, die, von westlicher Bildung unbeleckt, technokratisch-bürokratischem Voluntarismus frönte und erfüllt war von Vorstellungen eines russischen Auserwähltheitskultes. Vgl. Isaac Deutscher: Stalin: a political biography, Oxford University Press 1962, 337 f.
SPALTE3-AKTUELL-RUBRIK
Frühere Aktivitäten sind im Aktuell-Archiv aufgeführt. Dort gibt es auch einige Audio-Aufnahmen.
Alle bisher erschienenen Ausgaben der Bahamas finden Sie im Heft-Archiv jeweils mit Inhaltsverzeichnis, Editorial und drei online lesbaren Artikeln.