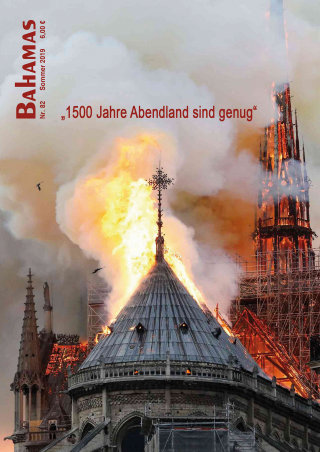Fürsorgliche Belagerung
Eine große Koalition der Deutschen ist sich in der Liebe zum „behinderten Leben“ überraschend einig
Bevor der Bundestag im vergangenen April über die Möglichkeit diskutiert hat, Schwangeren vorgeburtliche Bluttests auf Trisomie 21 als Kassenleistung zu gewähren, veröffentlichte die FDP-Fraktion als Stellungnahme zur bevorstehenden Aussprache einen Tweet, der ihr seitens der Social-Media-Gemeinde den Vorwurf „moralischer Verwahrlosung“ einbrachte. (1) Die Forderung „Trisomie-21-Test muss Kassenleistung werden!“ wurde dort mit einem Foto illustriert, das ein Kind mit Down-Syndrom auf dem Schoß seiner Mutter zeigte. Im begleitenden Text hieß es als Begründung der Forderung: „Jede Schwangere muss selbst & diskriminierungsfrei darüber entscheiden können, ob & welche Untersuchungen sie durchführen lässt & wie sie mit dem Ergebnis umgeht.“ Eine Koalition aus Christen und Feministinnen, Moralaposteln und Diversitätsfreundinnen, grünen und konservativen Lebensschützern drehte umgehend am Rad. Julia Klöckner (CDU), als Bundeslandwirtschaftsministerin offenbar auch für die Verteilungsquoten von Muttermilch zuständig, verlautbarte: „Ich kann gar nicht glauben, dass dieser FDP-Post echt sein soll! Mit diesem Kind im Bild zu verdeutlichen, bei einem Trisomie-21-Test wäre es vielleicht nicht auf der Welt, wenn der Test Kassenleistung wäre … Deshalb sei die FDP für ‚diskriminierungsfreie‘ Kassenleistung“. Christiane Müller-Zurek von der Lebenshilfe Berlin e.V. warnte gegenüber NTV: „Der Tweet der FDP diskriminiert Leben mit Down-Syndrom und schürt geradezu die Angst vor Behinderung“. Ihre Kollegin Ivonne Kanter, „selbst Mutter eines Sohnes mit Down-Syndrom“, verlangte vom Bundestag „ein klares Ja zur Vielfalt menschlichen Lebens“ und sah von ferne schon ein neues Auschwitz heraufdämmern: „Heute sollen Menschen mit Down-Syndrom aussortiert werden. Wer ist morgen dran?“ (2)
Propaganda der Lebensfreude
In der partei- und fraktionsübergreifenden Bundestagsdebatte, die folgte, als die FDP ihr Posting bereits als „missverständlich“ zurückgenommen hatte, (3) verwies Kirsten Kappert-Gonther (Bündnis 90/Die Grünen) auf Island, wo pränatale Tests auf Trisomie 21 flächendeckend eingesetzt werden, weshalb dort leider „kaum noch Kinder mit Down-Syndrom“ auf die Welt kämen, und forderte: „Diesen Normalfall darf es in Deutschland niemals geben.“ (4) Familien mit Kindern mit Down-Syndrom, glaubte sie zu wissen, seien „genauso glücklich oder unglücklich wie andere Familien auch“, sie litten nicht unter der Behinderung, sondern unter der verbreiteten „Behindertenfeindlichkeit“. Stephan Pilsinger (CDU/CSU) sprach sich gegen eine „eugenische Gesellschaft“ aus, in der „Designerbabys“ an der Tagesordnung wären, und befürchtete ebenso wie die Grüne Corinna Rüffer eine „Selektion“ von Ungeborenen. Dagmar Schmidt (SPD) warnte vor den ökonomischen Interessen der „Hersteller solcher Tests“, und Kathrin Vogler von der Linkspartei sekundierte, Trisomie-21-Bluttests seien, weil sie „mit dem Argument hoher Sicherheit umworben“ würden, sehr populär und müssten daher stärker reglementiert werden. Dass eine Kassenfinanzierung der Bluttests, die für Eltern, die sie aus eigener Tasche bezahlen, ohnehin schon möglich sind, zunächst einmal die Diskriminierung weniger zahlungskräftiger Frauen beseitigen würde, hatten vor allem Abgeordnete von FDP, AfD und Linkspartei gemerkt. Christine Aschenberg-Dugnus (FDP) forderte die „finanzielle Lage“ dürfe für die Entscheidung über eine Abtreibung „nicht entscheidend“ sein, und hielt fest, es gebe für Schwangere in Hinblick auf die Gesundheit ihres Kindes ebenso ein „Recht auf Wissen“ wie auf „Nichtwissen“. Cornelia Möhring von der Linkspartei wies darauf hin, dass die Angst insbesondere alleinerziehender Mütter vor „ökonomischer und sozialer Isolierung“ nicht auf Vorurteilen der Mütter gegenüber Behinderung, sondern auf der Lebensrealität beruhe, und Axel Gehrke (AfD), der das „Erkennen von Anomalien“ als legitimes „Informationsbedürfnis“ der Eltern verteidigte, warnte davor, eine Kassenfinanzierung der Tests zum „Untergang des Abendlandes“ zu stilisieren. Am präzisesten wurden die Argumente für eine Kassenfinanzierung vom SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach benannt: Während das bisherige pränatale Testverfahren, bei dem eine Hohlnadel über Bauchdecke und Gebärmutterwand in die Fruchtblase eingeführt wird, (5) für die Gesundheit der Frau und des Kindes risikoreicher sei, seien die Bluttests nicht nur „extrem verlässlich“, sondern auch gesundheitlich unbedenklich, also „schlicht viel besser“. Deshalb sei es nicht zu rechtfertigen, sie ökonomisch schlechter gestellten Eltern vorzuenthalten; vielmehr müssten sie begleitet von entscheidungsoffenen Beratungen jeder Frau zugänglich gemacht werden.
Unabhängig von ihrer Position zur Frage der Kassenfinanzierung überschlugen sich alle Abgeordneten in Lobgesängen auf das Glück der Elternschaft, die Schönheit der Welt und die Freude am Leben. Babys seien auf jeden Fall ein „wunderbares Geschenk“, das bunte Zauberland da draußen werde „von Vielfalt, Überraschung und auch durch das nicht Perfekte“ geprägt (Claudia Schmidtke, CDU), „wir alle seien Gott sei Dank verschieden“ und müssten das auch „akzeptieren“ (Wilfried Oellers, CDU/CSU), Mutterschaft sei „ein Grund zur Freude“ (Volker Münz, AfD), „Vielfalt und Menschlichkeit“ wichtiger als „Leistungsfähigkeit“ (Cornelia Möhring, Die Linke). Abgesehen davon, ob Kritiker, die das von der FDP gepostete Bild statt als schlichtes Symbolbild als Darstellung einer zu vermeidenden Situation und damit als Warnung vor Trisomie-21-Kindern deuten, nicht uneingestanden mehr „Angst vor Behinderung“ haben als Frauen, die sich einen Bluttest wünschen, stellt sich die Frage, weshalb niemand sich an der pausbäckigen Menschenverachtung von Leuten stört, die Behinderte nach dem Motto „Du bist nicht perfekt – ist doch klasse“ überreden wollen, gefälligst ihr „Anderssein“ zu „akzeptieren“; die in der Frage der Abtreibung nichtbehinderter Föten routiniert mit den Schultern zucken, sich aber bei Frauen, die nicht bereit sind, ein Trisomie-21-Kind zur Welt zu bringen, sofort kurz vor der Rampe wähnen; die ohne rot zu werden die Phrase wiederkäuen, Leistung sei nicht alles, aber ausgerechnet werdenden Müttern behinderter Kinder abverlangen, über ihren Schatten zu springen und die Sache durchzuziehen; und die sich zu solch gewohnheitsmäßiger Rohheit auch noch mit der wurstigen Formulierung bekennen, jede Familie sei eh so „glücklich oder unglücklich“ wie die andere.
Ob glücklich oder unglücklich, arm oder reich, geistvoll oder verdummt, Mensch oder Unmensch – jeder, der auf der Welt ist, muss sich am Leben freuen, weil man sich eine andere als die bestehende nicht vorstellen kann. In Wahrheit ist diese Haltung, die sich als Ausdruck von Lebensbejahung geriert, Zeugnis praktischer Lebensverachtung – jedenfalls, sofern man willens und fähig ist, „Leben“ nicht als allumfassenden Strom, der jeden Einzelnen hervorbringt und wieder verschlingt, sondern als individuiertes Leben aufzufassen, das in den einzelnen vergänglichen Menschen seinen Zweck und seine Bestimmung findet. Die unabweisbare Tatsache, dass ein Leben mit Behinderung für die Betroffenen und ihr Umfeld auch in einer „behindertengerechten“ Gesellschaft mehr Beschwernisse mit sich bringt als ein Leben ohne, dass also schon der antiableistische Slogan „Wir sind nicht behindert, wir werden behindert“ immer nur die halbe Wahrheit gewesen ist, (6) und dass deshalb das artenschützerische „Ja zur Vielfalt“, zu der selbstverständlich auch eine bunte Palette von Behinderungen gehöre, ebenso zynisch ist wie das Plädoyer, jede Behinderung präventiv zu vermeiden – all das wird nur darum nicht bemerkt, weil jeder weiß und keiner wissen will, dass in der Welt, aus der Trisomie-21-Kinder „aussortiert“ werden sollen, „Vielfalt und Menschlichkeit“ ausgesprochen selten zu finden und vernünftige Argumente für Lebenslust und Elternglück entsprechend rar sind. Nur weil es draußen fast nichts gibt, wofür es sich vor die Tür zu gehen lohnt; nur weil fast jeder spätestens bei Eintritt der Volljährigkeit mit der eigenen Zukunft abschließt; nur weil die sich bestenfalls alle fünfzehn Jahre mal ereignende Begegnung mit einem freien und daher liebenswerten Menschen von den allermeisten als größter anzunehmender Unfall der eigenen Biographie gefürchtet wird – nur deshalb wird die Geburt eines behinderten Kindes als ganz besondere „Überraschung“ gefeiert, während man das nichtbehinderte scham-, klag- und lieblos der demographischen Nachschubbehandlung überantwortet. Denn aus dem Nichtbehinderten, so die verächtliche Logik, die solcher Doppelmoral zugrunde liegt, wird irgendwann eh ein Normalbürger, während das Behinderte immer irgendwie anders und daher ein lebender Einspruch gegen die Normalität bleiben wird, unter der die Normalen keineswegs grundlos leiden, die aber von als unnormal Stigmatisierten oft genug aus mindestens ebenso guten Gründen herbeigewünscht wird.
Ein Nörgler und Misanthrop
Um das diabolische Ausmaß solch umgekehrter Lebensbornpolitik zu ermessen, lohnt sich ein Blick in das Werk eines österreichischen Nörglers, der in seiner Doppelfunktion als Naturwissenschaftler und misanthropischer Philosoph früh auf die Widersprüche einer menschenverachtenden Lebensfreude gestoßen ist, die aus der richtigen Einsicht, dass jedes Leben zu schützen sei, eine demagogische Weltanschauung macht, wonach es auf das Leben eher ankomme als auf die, die leben. Der 1905 in Czernowitz als Sohn österreichisch-ungarischer Juden geborene Erwin Chargaff, der in Wien ein Studium der Philologie und der Chemie absolvierte und ab 1935 im New Yorker Exil an der Columbia University arbeitete, entwickelte dort zwischen 1952 und 1968 die sogenannten Chargaff-Regeln über die Basiszusammensetzung doppelsträngiger DNA. (7) Seit den späten Siebzigern veröffentlichte er eine Reihe von Bänden mit Essays und Aphorismen, die auf Deutsch meist bei Klett-Cotta erschienen sind und sich in der Tradition des anthropologischen Materialismus von Arthur Schopenhauer, Karl Kraus oder auch des italienischen Dichters und Philosophen Guido Ceronetti mit dem Lebensbegriff der Naturwissenschaften und dessen Beziehung zur Sphäre des Somatischen beschäftigen. (8) Defätismus, Fatalismus sowie die Überzeugung von der Unbezwingbarkeit der Natur und damit der menschlichen Sterblichkeit, die häufig als Zeichen für die Fortschrittsfeindlichkeit Chargaffs angeführt werden, zeugen bei ihm in Wahrheit von einer Treue zum zufälligen, vergänglichen und eben deshalb untauschbaren, an nichts als sich selbst zu messenden Einzelnen. Diese Haltung führt Chargaff zu einer Grundlagenkritik an Genetik, Präimplantationsdiagnostik und pränataler Medizin, die den Verteidigern des „Rechts auf Nichtwissen“ im Blick auf mögliche Behinderungen von Kindern zu ähneln scheint, sich aber in der strikten Weigerung, angeborenes Leid als lebensfreundliche Bereicherung zu bejahen, von ihnen unterscheidet.
Ein 2001, ein Jahr vor seinem Tod, mit Chargaff geführtes Interview illustriert die Doppelgesichtigkeit seiner Zivilisationskritik, die einerseits naturwissenschaftlichen und medizinischen Fortschritt zum Katastrophenzusammenhang stilisiert, in jedem Arzt einen potentiellen KZ-Gehilfen auszumachen glaubt und jeden Versuch technischer Beherrschbarkeit menschlichen Lebens als Sünde verdammt, andererseits aber nicht davon ablässt, die blinde Herrschaft erster Natur als menschenfeindlich anzuprangern und die Überzeugung, menschliches Glück bestehe darin, in Übereinstimmung mit jener zu leben, unermüdlich verhöhnt. (9) An Chargaffs polemischer Misanthropie zeigt sich so eine Menschenfreundlichkeit, die den redseligen Verteidigern von Diversität und Vielfalt, die statt vom Leben Behinderter vom „behinderten Leben“ sprechen, gerade abgeht. Chargaff unangemessene Verallgemeinerungen vorzuwerfen, fällt allerdings leicht. Die Versuche genetischer Manipulation menschlichen Lebens und das „Herummachen an Embryonen“ sind für ihn „Verbrechen“, Naturwissenschaftler und Ärzte „gaunerische Marktschreier“, die „einen Krieg gegen die Natur“ führen. Die Naturwissenschaft sei seit Hiroshima eine „Todeswissenschaft“, ihre Protagonisten nennt er „die Taliban der Moderne“. Dem Molekularbiologen James Watson, der proklamierte, das Schicksal der Menschen liege statt in den Sternen in den Genen, wirft er vor, die „Züchtung des Übermenschen“ anzustreben, und der Präimplantationsdiagnostik unterstellt er, gleich einem „verbesserten Hitler“ gesundes und krankes Leben voneinander selektieren zu wollen. Der Fortschritt, meint er, sei ein „nicht aufhaltbarer Schrecken“, naturwissenschaftlichen Forschern und Ärzten werde so bedingungslos geglaubt wie früher den „Schamanen“. (10) Werdende Mütter, die sich aufgrund medizinisch erworbenen Vorwissens gegen oder auch für ein Kind mit Trisomie 21 entscheiden, agieren für Chargaff, der „Nichtwissen […] eine Gnade“ und „Ungewissheit […] das Salz des Lebens“ nennt, wie Lebenszüchter „an der Rampe“.
Obwohl Chargaffs Ausführungen bis in die Wortwahl den Warnungen vor „Designerbabys“ und vor „Aussortierung“ von Embryonen ähneln, ist seine Haltung unvereinbar mit einer Diversitätspropaganda, die werdende Mütter im Namen der „Vielfalt menschlichen Lebens“ moralisch erpresst, im Falle potentieller Behinderung des Kindes auf einen Schwangerschaftsabbruch zu verzichten, (11) oder dreist unterstellt, Familien mit behinderten Kindern seien „so glücklich oder unglücklich“ wie alle anderen. Dafür nimmt er den Begriff des Glücks und des Leidens zu ernst. Die Negativität des Bestehenden und ihr Niederschlag in der leiblichen Erfahrung, die für Propagandisten pränataler Diversität Anathema sind, bilden für Chargaff vielmehr den Ausgangspunkt seiner Kritik an einem naturwissenschaftlich-medizinischen Optimismus, der behauptet, dass „alles reparabel sei“. Darauf antwortet er mit dem Plädoyer für eine gesellschaftliche Praxis, die das Nichtreparable in seiner Negativität und Beschwernis achtet und ihm abzuhelfen sucht, statt es zu verleugnen oder gar zu bejahen. Wenn er sich beklagt: „Ich kann fast nicht mehr allein auf die Toilette gehen, ich humple am Stock – das ist kein Zustand, ich müsste verschwinden. Ich bin wie ein Huhn, das keine Eier mehr legt. Ich habe das Leben satt, mir tut das Rückgrat weh, die ganze Zeit“, nur um sich sogleich zu beschweren, heutige Ärzte würden ihm eher „ein neues Rückgrat installieren“, als „einen angenehmen Stuhl zu konstruieren“, plädiert er nicht für Euthanasie, (12) sondern wendet sich gegen ein Ideal möglichst langen Lebens, dem jede qualitative Bestimmung des Lebens, das da lang sein möge, abhanden gekommen ist – also gegen die Ersetzung der Rede vom unwiederholbaren einzelnen Leben durch „das Leben“, aus dem das einzelne hervorgehe, um wieder darin aufzugehen. Und wenn Chargaff auf die Diagnose „Die Menschlichkeit ist zu Ende gegangen“ den Satz „Die Natur geht einfach weiter“ folgen lässt, stellt er klar, dass das Ende der Menschlichkeit nicht einfach dem Sieg von Technik und Medizin entspringt, sondern dem unaufgehobenen Naturzwang, der sich blind in der menschlichen Praxis wiederholt: dass in verkehrten menschlichen Verhältnissen die Natur trotz aller Fortschritte von Wissenschaft und Medizin nach wie vor das ist, was über die Menschen hinweggeht, statt sich glücklich mit ihnen zu verbinden.
Feminismus und Neukatholizismus
Verdankt sich Chargaffs scheinbar inhumaner Defätismus dem Bemühen, die Einzelnen, die leben, gegen „das Leben“ zu verteidigen, drückt sich in der diversitätsbegeisterten Verteidigung der „Vielfalt menschlichen Lebens“ gegen die egoistischen Wünsche der Lebenden das Bedürfnis aus, die Lebenden noch im Stande ihrer formalen Mündigkeit auf „das Leben“ zu vereidigen. In welchem Maße dieses Bedürfnis der intellektuellen Konsequenz in die Quere kommt, zeigt sich daran, dass in ihm Feministinnen, für die gewöhnliche Föten auskratzbare Zellhaufen sind, und neukatholisch mutierte Antideutsche, die immer noch bei jeder Gelegenheit vom Individuum schwadronieren, plötzlich einig werden. Exemplarisch für den ersten Typus ist Kirsten Achtelik, die in ihrem Buch Selbstbestimmte Norm (13) zwar einerseits die vor einem Schwangerschaftsabbruch vorgesehene Pflichtberatung, die der Notwendigkeit einer Abwägung zwischen den Rechten des Ungeborenen und der Schwangeren Genüge tun soll, in schlechter feministischer Tradition als „Zwangsberatung“ diffamiert, aber andererseits immer dann, wenn sie Möglichkeiten pränataler Diagnostik, insbesondere in Verbindung mit der Früherkennung von Behinderungen, diskutiert, sofort von Abtreibungspropaganda auf moralische Nötigung umschaltet. Das klingt dann so: „Wenn Menschen schwanger sind und ein Kind bekommen wollen, gibt es viele vorgeburtliche Untersuchungen (Pränataldiagnostik). Das ist mittlerweile ein normaler Vorgang im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen für Schwangere geworden, die immer mehr Personen wie [!] selbstverständlich in Anspruch nehmen. Manche dieser Untersuchungen sind wichtig und notwendig, damit es der schwangeren Person und dem werdenden Kind gut geht und sie gesund sind. Die meisten Untersuchungen suchen aber [!] nach möglichen Behinderungen und Abweichungen des Fötus. Diese Untersuchungen erzeugen sehr viel Unsicherheit und Angst bei den Betroffenen. Wenn eine Behinderung des Fötus festgestellt wird, kann man meistens nichts unternehmen, damit es der schwangeren Person und dem späteren Kind besser geht. Zwar kann es sinnvoll sein, von bestimmten Behinderungen zur Vorbereitung der Geburt zu wissen. Oft steht die schwangere Person nach einer Diagnose aber vor der Entscheidung, ob sie das Kind ‚trotzdem‘ bekommen will, oder ob sie deswegen eine Abtreibung haben will.“ Vorgeburtliche Untersuchungen sind diesen Ausführungen zufolge im Grunde immer etwas Unselbstverständliches, weil Technisches; sie manipulieren das Selbstverhältnis der Frau gemäß gesellschaftlichen Normen und werden nur aufgrund der Verinnerlichung solcher Normen „wie selbstverständlich“ in Anspruch genommen. Dass der aus Unsicherheit entspringenden Angst, ein behindertes Kind zur Welt zu bringen, durch eine vorgeburtliche Untersuchung auch abgeholfen werden, dass die Suche nach „Behinderungen und Abweichungen des Fötus“ der Gesundheit der Schwangeren und damit des Kindes zugute kommen kann, gerät nicht in den Blick. Im Gegenteil wird ohne empirische Belege unterstellt, die Untersuchungen selbst seien es, die „Unsicherheit und Angst“ erzeugten.
Warum die Abwägung zwischen dem eigenen Selbstbestimmungsrecht und dem Recht des Ungeborenen, die jede vor der Entscheidung zu einer Abtreibung stehende Frau vornehmen muss und auch vornimmt, selbst wenn sie es verleugnet, (14) im Falle eines behinderten Kindes grundsätzlich prekärer sein soll als im Falle eines gesunden, wird nicht erläutert. Vielmehr wird die Frau, deren Inanspruchnahme des Rechts auf Abtreibung ansonsten eher nur noch proklamiert als begründet zu werden pflegt, im Fall eines möglicherweise behinderten Kindes verdächtigt, anfällig für Indoktrination, ja eine potentielle Ausmerzerin lebensunwerten Lebens zu sein. So wird die Schwangere, die sich nicht zutraut oder auch einfach weigert, ein behindertes Kind zur Welt zu bringen, von Achtelik mit eiskalter Menschenfreundlichkeit belehrt: „Behinderung wird […] vielfach immer noch mit Sorgen, Leid und Schmerzen verbunden – eine ableistische und behindertenfeindliche Einstellung. Die gesellschaftliche Bereitstellung von Ressourcen für die gezielte pränatale Suche nach Abweichungen und Behinderungen (via Regelfinanzierung durch die Krankenkassen) zeigt, dass es weiterhin als normal und unproblematisch gilt, Behinderung um beinahe jeden Preis [!] vermeiden zu wollen. […] Die geläufigen Vorstellungen von Behinderung […] folgen einem medizinisch-individualistischen Modell von Behinderung. […] Dieses gesellschaftlich dominierte Bild von Behinderung erschwert es, sich vorzustellen, dass ein Kind, käme es mit einer Behinderung zur Welt, ein ganz gutes [!] Leben haben könnte.“ Die Schlussformel, die die Forderung nach einem guten Leben für alle auf den schalen Trost herunterbringt, dass auch Behinderte irgendwie klarkommen werden, ohne zugrunde zu gehen, zeigt, wie viel Resignation, Konformismus und Abstumpfung in all dem dick aufgetragenen Empowerment steckt. Weil man nichts davon wissen will, dass Behinderte nicht nur unter der Gesellschaft, sondern auch unter ihrer Behinderung leiden, macht man aus der Entscheidung zur Abtreibung eines behinderten Fötus die Vermeidung von Behinderung „um beinahe jeden Preis“, also die Bereitschaft zur Euthanasie, und kritisiert gleich noch durch die Blume die „Regelfinanzierung durch die Krankenkassen“, die im Falle der Abtreibung von Normföten natürlich weiter gern beansprucht wird.
Fällt so der Feminismus jenem Moralismus zum Opfer, der von Beginn an in ihm steckte, werden antideutsche Jungmänner angesichts dessen, was sie für die „Forderung nach einer Verbesserung der Euthanasierung behinderter Menschen im Mutterleib“ halten, derart kategorisch, dass sich auch mit Monty Python (15) nichts mehr gegen sie ausrichten lässt. Auf der Facebook-Seite „Ideologiekritische Aktion“, (16) die sich nicht zu schade ist, mittels geteilter Postings von Vorher-nachher-Bildern vermeintlicher Feministinnen zu demonstrieren, dass weibliche Emanzipation Frauen fett, hässlich und verwahrlost mache, empört sich ein Mister Namenlos, nachdem er Widerspruch wegen seiner Kritik an der FDP-Forderung erhalten hat: „Mir war auch nicht klar, dass hier so viele Menschen die Frage menschlichen Lebens rein technisch oder biologistisch diskutieren wollen. Insofern scheinen die Verheerungen, die das Ende des Christentums in Europa ausgelöst hat, doch gravierender als man denken mag, zumal an dessen Stelle offenbar keine aufgeklärte, sondern eine rein instrumentelle Ethik getreten zu sein scheint“, und droht umgehend eine Kondomrationierung für Bahamas-Leser an: „Die Frage, wo menschliches Leben beginnt und ob jedes Spermium heilig sein soll, mit der muss man sich schon auseinandersetzen.“
Unter dem Ende des Christentums machen sie es nicht mehr, wenn es darum geht, „die Frage des menschlichen Lebens“ gegen das rein technische und rein instrumentelle Denken von Frauen zu verteidigen, denen ihre Lebensbedingungen oder auch einfach ihre vernünftigen Egoismen den Blick dafür versperren, dass sie nicht allein einzelne Menschen, sondern fruchtbarer Boden heiligen Saatguts sind. Zwar ist man noch zuzugestehen bereit, dass die Entscheidung für oder gegen eine Abtreibung auch im Falle eines möglicherweise behinderten Kindes Ergebnis einer „Abwägung“ seitens der Frau sein muss – das stand ja in der Bahamas, und was da drinsteht, stimmt –, aber trotzdem unterstellt man jeder, die sich als Ergebnis solcher Abwägung gegen das Kind entscheidet, „lebensfähigen, aber […] behinderten Kindern das Lebensrecht“ abzusprechen und „sie zu einer reinen Belastung“ zu erklären. Dass das geborene Kind zwar aus dem ungeborenen hervorgeht, weshalb auch das ungeborene als Rechtsperson zu gelten hat, dass aber doch die erwachsene Frau sich vom Ungeborenen dadurch unterscheidet, dass sie Trägerin von Bürgerrechten ist (17) und ihr die Entscheidung darüber, was sie mit ihrem Körper macht, nicht von selbsternannten Moralphilosophen abgenommen werden darf, solche Petitessen müssen hintangestellt werden, wenn es um die Verteidigung eben nicht der lebenden Menschen, sondern „des menschlichen Lebens“ geht.
Der Frauenleib als öffentlicher Ort
Wenn Schwangerschaftsabbrüche auf Wunsch der Schwangeren und bei Absolvierung einer Beratung bis zur 12. Schwangerschaftswoche in der Regel straffrei bleiben, (18) verdankt sich das auch dem Bemühen, die bei späten Abbrüchen fließende Grenze zwischen Spätabtreibung und Frühgeburt im Sinne einer Verteidigung des Personenstatus des Ungeborenen gegenüber dem Persönlichkeitsrecht der Schwangeren zu wahren. Mit Hilfe der Bluttests, für die die FDP in ihrem Posting geworben hat, kann Trisomie 21 bei Ungeborenen schon ab der vollendeten 9. Schwangerschaftswoche diagnostiziert werden, die ärztliche Empfehlung geht dahin, bis zur 11. Woche zu warten. Eine gute weitere Woche später hat die Schwangere in diesem Fall Gewissheit über das Testergebnis, während sie mit der bislang allein kassenfinanzierten invasiven Methode darauf in der Regel bis zur 18. Schwangerschaftswoche warten muss. (19) Obwohl Schwangerschaftsabbrüche im Fall einer Trisomie-21-Diagnose ohnehin nach medizinischer Indikation geregelt und somit Spätabtreibungen straffrei möglich sind, (20) erleichtert der Bluttest als Diagnoseinstrument also einen Abbruch im für gewöhnliche Abtreibungen vorgesehenen Zeitrahmen und müsste daher gerade von Leuten, die der rechtlichen Ausweitung der Möglichkeit von Spätabtreibungen skeptisch gegenüberstehen, eher verteidigt werden. Dass dies nicht geschieht, dass vielmehr der Generalvorbehalt gegenüber Abtreibungen von Föten mit diagnostizierter Behinderung im Fall des Bluttests sogar schärfer formuliert wird als gegenüber der invasiven Testvariante, spricht dafür, dass moralische Kriterien die Oberhand erlangt haben, und zwar nicht aufgrund des Zeitpunkts und der Umstände des Schwangerschaftsabbruchs, sondern wegen der Qualität des werdenden Lebens, um das es geht. Während man bei der Abtreibung eines Normfötus weit eher bereit ist, Urteilsvermögen und Entscheidungsfähigkeit der Frau gegenüber dem Recht des Ungeborenen zu verteidigen, wird bei der Diskussion über Abtreibungen behinderter Föten dem Ungeborenen wie als symbolische Kompensation seines Gebrechens ein stärkerer Subjektstatus zugestanden als der Mutter, die statt als urteilsfähiges Subjekt eher als potentielle Täterin erscheint, die in Gefahr sei, ihren Subjektstatus zur Schädigung des ungeborenen Lebens zu missbrauchen.
Die Neigung, Fortschritte pränataler Diagnostik statt als Stärkung der Entscheidungsfähigkeit der Frau als Bedrohung ihrer Autonomie anzusehen, findet sich exemplarisch in Barbara Dudens Studie Der Frauenleib als öffentlicher Ort, (21) die gegenüber den Ermahnungen einer Kirsten Achtelik von größerem Interesse ist, weil sie die Hypostasierung des „Lebens“ zum überindividuellen Begriff, der mehr meine als das Leben der Einzelnen, ausdrücklich kritisiert. Indem „Leben“ nicht mehr das an die Einzelnen gebundene „Körpererlebnis“ bezeichne, sondern „einen Vorgang, in dem dieses Erlebnis ausgelöscht wird“, nämlich „Organisationsstadien von Chromosomen und Geweben, die nur unter Laborbedingungen verifizierbar sind“, indem mithin ein naturwissenschaftlich gewonnener Lebensbegriff als moralphilosophische, juristische und politische Kategorie gesetzt werde, drohe die Rede vom „Leben“, statt der Erkenntnis förderlich zu sein, zum Medium von „Trug und Wahn“ zu werden. (22) Statt aber das Verhältnis zwischen naturwissenschaftlichem, medizinischem, juristischem und philosophischem Lebensbegriff in seiner Genese zu entfalten, unterstellt Duden, dass Staat, Kirche und Medizin, wenn sie vom Leben sprechen, in ihrer Abstraktheit letztlich austauschbare Begriffe „des Lebens“ voraussetzten und so von sich aus bereits die Sphäre des Körpererlebnisses, das für die Beurteilung von Schwangerschaft entscheidend sei, überspringen würden. Alle Tendenzen der Verallgemeinerung und Kodifikation des Lebensbegriffs deutet sie in dieser Hinsicht negativ: „Der Bundestag übernimmt das Mandat, die Rechte von Subjekten zu regeln, für deren Existenz es im juristischen Sinne keine Augenzeugen geben kann. Die Kirche, deren Kenntnis des Menschenwesens aus der Offenbarung und nicht aus der Naturwissenschaft stammt, tritt als Hüterin dieser ungetauften menschlichen Zellhaufen auf. Der Auftrag des Arztes, der in der Linderung des Leidens von Personen bestand (und zwar von ihrer Geburt bis zu ihrer Sterbestunde), wird durch eine neue medizinische Ethik auf die Verwaltung menschlicher Gensubstanz ausgedehnt […]. Es scheint so, als hätte die Wissenschaft immer schon nach dem Entstehen ‚eines‘ Lebens gesucht, als hätte die Ärzteschaft immer schon das Ungeborene als Patienten beansprucht, als hätte der Gesetzgeber schon seit Hunderten von Jahren das Leben im Leib – und nicht Söhne, Rekruten, Knechte, Erben schützen wollen, als hätte die Kirche immer schon menschliche Existenz mit ‚Leben‘ gleichgesetzt.“ (23)
So gewiss es zutrifft, dass Veränderungen in Wissenschaft, Medizin und Recht dazu tendieren, ihre Genese vergessen zu machen und sich als unmittelbar Gültiges zu setzen, blendet diese Betrachtungsweise das Fortschrittsmoment aller Abstraktion zugunsten einer an Foucault geschulten Fetischisierung des Unmittelbaren, Vorbegrifflichen aus. Nicht erst in Bezug auf den menschlichen Fötus zielt die Rede vom Recht auf etwas, für das es „keine Augenzeugen geben kann“. Vielmehr bezeichnet der Titel der Rechtsperson auch bezogen auf geborene Menschen etwas notwendig Unterstelltes, dessen fiktionaler Anteil – dass es im empirisch Überprüfbaren nicht aufgeht – gerade seinen Wahrheitsgehalt ausmacht. Auch das Ungeborene als Rechtsperson zu setzen, verdankt sich keiner Hypostasierung des naturwissenschaftlichen Lebensbegriffs, sondern der konsequenten Universalisierung des Begriffs der Rechtsperson selbst. Ganz ähnlich ist die Forderung nach dem Schutz ungeborenen Lebens, sofern die Kirche überhaupt noch daran festhält, abgeleitet aus dem Begriff der Schöpfung, der in „ungetauften menschlichen Zellhaufen“ bestenfalls seine unzulängliche Illustration, aber nicht seine Fundierung findet. Der „Auftrag des Arztes“ schließlich beschränkt sich nur für einen kruden Positivismus auf die Zeit zwischen „Geburt und Sterbestunde“, sondern hat von der Antike bis zur Gegenwart stets die Regelung der Übergänge zwischen Leben und Tod umfasst. (24) Weil sie solche Vermittlungen überspringt und das Moment der Abstraktion in Naturwissenschaft, Medizin und Recht dem „Körpererlebnis“ als Richtmaß blank gegenüberstellt, ist die pränatale Diagnostik für Duden eine Form der Manipulation, die dem weiblichen Körper den Begriff „des Lebens“ einschreibt. Dass sie auch dazu dienen kann, die individuelle Frau gegen Fremdbestimmung und Entmündigung zu stärken, kommt ihr nicht in den Sinn. So wird der Frauenleib bei ihr durch Ultraschall zur „Vitrine“ (25) und das Ungeborene durch Pränataldiagnostik zum „öffentlichen Fötus“ (26), zur „Rechtsfiktion im Unterleib“. (27) Ob der Frauenleib entgegen der Titelthese von Dudens Buch nicht gerade dadurch zum „öffentlichen Ort“ zu werden droht, dass der Frau die durch Ultraschall oder Bluttest gegebene Möglichkeit besserer Erkenntnis und Beherrschung der ersten Natur aus der Hand genommen wird, um sie ihrer Körpererfahrung auszuliefern; (28) ob nicht, wer dem Recht sein fiktionales Moment abspricht, die Rechtssubjekte erst recht unmittelbarer Gewalt überantwortet, das fragt Duden so wenig wie die von ihr kritisierten Lebensschützer, die „das menschliche Leben“ gegen die Lebenden ausspielen.
Harmlosigkeit und Herrschaft
Betrachtet man die medizinkritisch daherkommende Ächtung der Abtreibung von Ungeborenen mit Trisomie-21-Diagnose aus dem Blickwinkel von Chargaffs negativer Anthropologie, erscheinen die Mahnungen zum besonderen Schutz „behinderten Lebens“ weniger als Kritik an einer instrumentellen und daher inhumanen Ethik denn als Teil einer ihrerseits menschenfeindlichen Fürsorgeoffensive, die für „das Leben“ vor allem deshalb Partei ergreift, um die einzelnen Lebenden auf Dauer hilflos und damit schutzbedürftig zu halten. Dass Kinder mit Down-Syndrom in dieser Diskussion eine so prominente Rolle spielen, scheint genau mit diesem Bedürfnis zu tun zu haben. Trisomie 21 prägt sich meist als Mischform körperlicher und geistiger Behinderung aus, die auch mit sensorischen Beeinträchtigungen wie Schwerhörigkeit, mit Störungen der Selbstwahrnehmung und einer Schwächung des Immunsystems einhergehen kann. Trotzdem können die Betroffenen bei angemessener Betreuung und Erziehung in der Regel als Erwachsene ein unabhängiges Leben führen; dank der besseren medizinischen und therapeutischen Behandlungsmethoden ist die durchschnittliche Lebenserwartung von Menschen mit Trisomie 21 von neun Jahren im Jahr 1929 heute auf 60 Jahre gestiegen. Zugleich heben Mediziner und Eltern von Betroffenen hervor, dass Menschen mit Down-Syndrom wegen ihrer eingeschränkten Fähigkeit zum Affektausdruck und ihrer verlangsamten Reaktionsfähigkeit sanfter, „rezeptiver“ und ruhiger wirken als Altersgenossen ohne Behinderung. Überdies verfügten sie über „deutliche Stärken im sozialen Funktionieren“ und seien „weniger anstrengend […] als gleichaltrige andere Kinder“. (29) Gerade die Geschichte des Umgangs mit dem Down-Syndrom vermag so zu illustrieren, dass Behinderung nicht einfach Schicksal ist, sondern sich durch den gesellschaftlichen Umgang mit ihr verändern kann.
Neben der Sozialgeschichte, die von der Einbettung der Behinderung in institutionelle und alltägliche Kontexte erzählt, gibt es aber auch eine Imaginationsgeschichte der Behinderung, die sich auf deren Wirklichkeit nicht minder und oft fatal auswirkt. In ihr spielt das Down-Syndrom nicht zuletzt deshalb eine exponierte Rolle, weil es die Koinzidenz von Bedürftigkeit und Harmlosigkeit symbolisiert, die alle Fürsorge und damit alle gesellschaftliche Herrschaft sich vom Gegenstand ihrer Zuwendung wünscht. Weder hoffnungslose Fälle noch aggressive Krüppel, scheinen Menschen mit Down-Syndrom auf besonders auffällige Weise das zu sein, was nach dem unausgesprochenen Wunsch passionierter Fürsorgeapostel am besten alle Menschen sein sollen: Kind gebliebene Erwachsene, die sich zwar selbst erhalten können, zu diesem Zweck aber beständiger Zuwendung seitens selbsterklärter und von ihnen geliebter Vormünder bedürfen; harmlos und hilfsbedürftig, eingeschränkt mündig und deshalb ungefährlich. Mütter, die sich kein solches Kind wünschen, votieren dieser Imagination zufolge herrisch und egoistisch gegen die moralisch camouflierte Allianz von Harmlosigkeit und Herrschaft, Sanftheit und Gewalt, und gegen eine fordernd auftretende Fürsorglichkeit, die Menschen nur dann liebt, wenn man keine Angst vor ihrer Freiheit haben muss. Aber wie gesagt: Dabei handelt es sich um eine Imagination, die mit der Wirklichkeit der Behinderung nicht in eins fällt. Sollten diejenigen, die nach Meinung fürsorglicher Lebensschützer „das behinderte Leben“ verkörpern, sich ihrer betreuerischen Verurteilung zur Harmlosigkeit einmal mit ähnlicher Konsequenz entziehen wie die Frauen der ihnen verordneten Verpflichtung aufs „Leben“, indem alle gleichermaßen die ihnen erpresserisch aufgezwungene Fürsorge ausschlagen, dann könnte sich im Verhältnis von Behinderung und Normalität wirklich etwas ändern.
Magnus Klaue (Bahamas 82 / 2019)
Anmerkungen:
- Dieses und die folgenden Zitate aus: www.nrz.de/politik/fdp-erntet-scharfe-kritik-fuer-tweet-zu-trisomie-21-bluttest-id216808221.html.
- vgl.: www.n-tv.de/politik/Kopfschuetteln-ueber-FDP-Tweet-zu-Trisomie-21-article20942209.html.
- vgl.: www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/downsyndrom-fdp-loest-mit-tweet-zu-bluttest-e mpoerung-aus-a-1260890.html.
- Dieses und die folgenden Zitate aus: www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw15-de-genetische-bluttests-633704.
- Auch invasive Tests auf Trisomie 21 sind zuverlässig, aber für die Frau unangenehmer und anstrengender. Außerdem erhöhen sie die Wahrscheinlichkeit von Fehlgeburten. Vgl.: www.test.de/Trisomie-Blut-statt-Fruchtwasser-testen-lassen-5370247-0/.
- Die im Kampf für Gleichstellung nützliche Aussage „Nicht unsere Körper sind falsch, sondern die Gesellschaft, die nicht für sie eingerichtet ist“ wird in diesem Milieu mit der Kritik an durch Schönheitsideale vermittelten „Körpernormen“ vermischt, als ließe sich Behinderung in ein ästhetisches Phänomen auflösen. Siehe etwa: https://strassenauszucker.tk/2012/06/wir-sind-nicht-behindert-wir-werden-behindert/. – Die „Krüppelbewegung“ in der Bundesrepublik der siebziger Jahre ist u.a. aus deutschen Kriegsopferverbänden hervorgegangen, was die Blickverlagerung weg von der Lebensgeschichte der behinderten Individuen zur „behindernden“ Gesellschaft begünstigt haben dürfte.
- vgl.: www.spektrum.de/lexikon/biologie-kompakt/chargaff-regeln/2271.
- Weil er politisch schwer einzuordnen ist, wird dieser eher von der Naturgeschichte des Leibes als von der politischen Ökonomie ausgehende Materialismus oft als reaktionär abqualifiziert. Siehe Alfred Schmidt: Drei Studien über Materialismus. Schopenhauer. Horkheimer. Glücksproblem, München, Wien 1977. Zum Verhältnis von Arzt und Philosoph empfiehlt sich das bösartige und scharfsinnige Buch von Guido Ceronetti: Das Schweigen des Körpers. Materialien und Gedanken zu einem Studium der Medizin, Frankfurt a. M. 1979.
- vgl.: www.dijg.de/analysen-zeitgeist/erwin-chargaff-genmanipulation-dna/. Hieraus die folgenden Chargaff-Zitate.
- Falsch ist das nicht. Die Mischung aus Furcht und Achtung, die dem Stand der Ärzte bis heute entgegengebracht wird und die klandestinen Aspekte ihres Berufs stärkt, beerbt in mancher Hinsicht den Stand der Schamanen. Vgl. den trotz Überspitzungen instruktiven Band von Carl Wiemer: Krankheit und Kriminalität. Die Ärzte- und Medizinkritik der kritischen Theorie, Freiburg i. Br. 2001.
- Im Gegenteil ist er bei der Beurteilung dessen, wie Einzelne mit den zugänglichen medizinischen Möglichkeiten umgehen, sympathisch liberal. Den Hinweis des Interviewers auf eine Französin, die „als erste Frau der Welt ein geklontes Kind zur Welt bringen will“, beantwortet er einfach: „Sie soll es probieren.“
- Zum Folgenden Erwin Chargaff: Unbegreifliches Geheimnis. Wissenschaft als Kampf für und gegen die Natur, Stuttgart 1998.
- Kirstin Achtelik: Selbstbestimmte Norm. Feminismus, Pränataldiagnostik, Abtreibung, Berlin 2015. Vgl. auch: www.kirsten-achtelik.net/2017/04/17/selbstbestimmung-abtreibung-b ehinderung/. Hieraus die Zitate.
- vgl. Magnus Klaue: Vollendete Abtreibung, in: Bahamas 81 (2019), 67 ff.
- „Every sperm is sacred, / Every sperm is good, / Every sperm is needed / In your neighbourhood”.
- vgl.: www.facebook.com/IdeologiekritischeAktion/. Hieraus die folgenden Zitate.
- Worin sich das Ungeborene glücklicherweise von der Mutter unterscheidet. In der Nivellierung dieses Unterschieds sind sich fundamentalistische Abtreibungsgegner, die den Fötus de facto als prospektiven Staatsbürger ansehen, mit staatskritisch daherkommenden Feministinnen einig, die dem Ungeborenen, weil es kein Staatsbürger ist, den Titel der Rechtsperson vorenthalten wollen.
- vgl.: www.familienplanung.de/beratung/schwangerschaftsabbruch/rechtslage-und-indikationen/.
- vgl.: www.baby-und-familie.de/Schwangerschaft/Schwangerschaft-Bluttest-auf-Trisomie-21 -489957.html.
- Unter die medizinische Indikation fällt der Abbruch von Schwangerschaften, mit denen eine schwere körperliche oder psychische Gefährdung für Kind oder Mutter einhergeht. Vgl.: www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/schwangerschaft-und-kinderwunsch/schwangerschaftsabbruch/schwangerschaftsabbruch-nach---218-strafgesetzbuch/81020.
- Barbara Duden: Der Frauenleib als öffentlicher Ort. Vom Missbrauch des Begriffs Leben, München 1994.
- ebd., 132.
- ebd., 132 f.
- Siehe hierzu das erwähnte Buch von Guido Ceronetti.
- Duden, a.a.O., 44 ff.
- ebd., 65 ff.
- ebd., 72 ff.
- An die Stelle medizinischer Diagnostik sollte, so legt Duden nahe, wieder der weibliche Körper als „bewegungsbezogenes Orientierungserlebnis“ treten: „Flüsse drängen nach oben oder unten, nach innen oder nach außen; das Geblüt wallt in den Kopf oder wird zu den Füßen gezogen“. (ebd., 117 f.) Die Begriffslosigkeit solch animistischer Salbaderei war mitverantwortlich dafür, dass in vergangenen Jahrhunderten nicht nur viele Kinder, sondern auch Mütter während der Geburt gestorben sind: Der Körper, der nur erlebt wird, ohne begriffen zu werden, ist der ersten Natur ohnmächtig ausgeliefert.
- vgl.: www.ds-infocenter.de/downloads/lm ds_49_mai2005.pdf. Hieraus die Zitate.
SPALTE3-AKTUELL-RUBRIK
Frühere Aktivitäten sind im Aktuell-Archiv aufgeführt. Dort gibt es auch einige Audio-Aufnahmen.
Alle bisher erschienenen Ausgaben der Bahamas finden Sie im Heft-Archiv jeweils mit Inhaltsverzeichnis, Editorial und drei online lesbaren Artikeln.