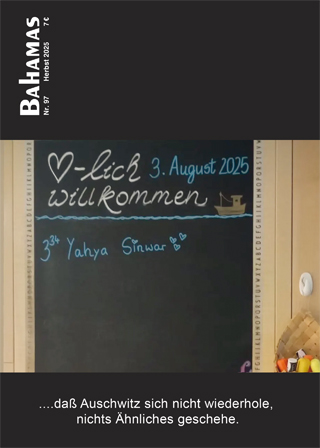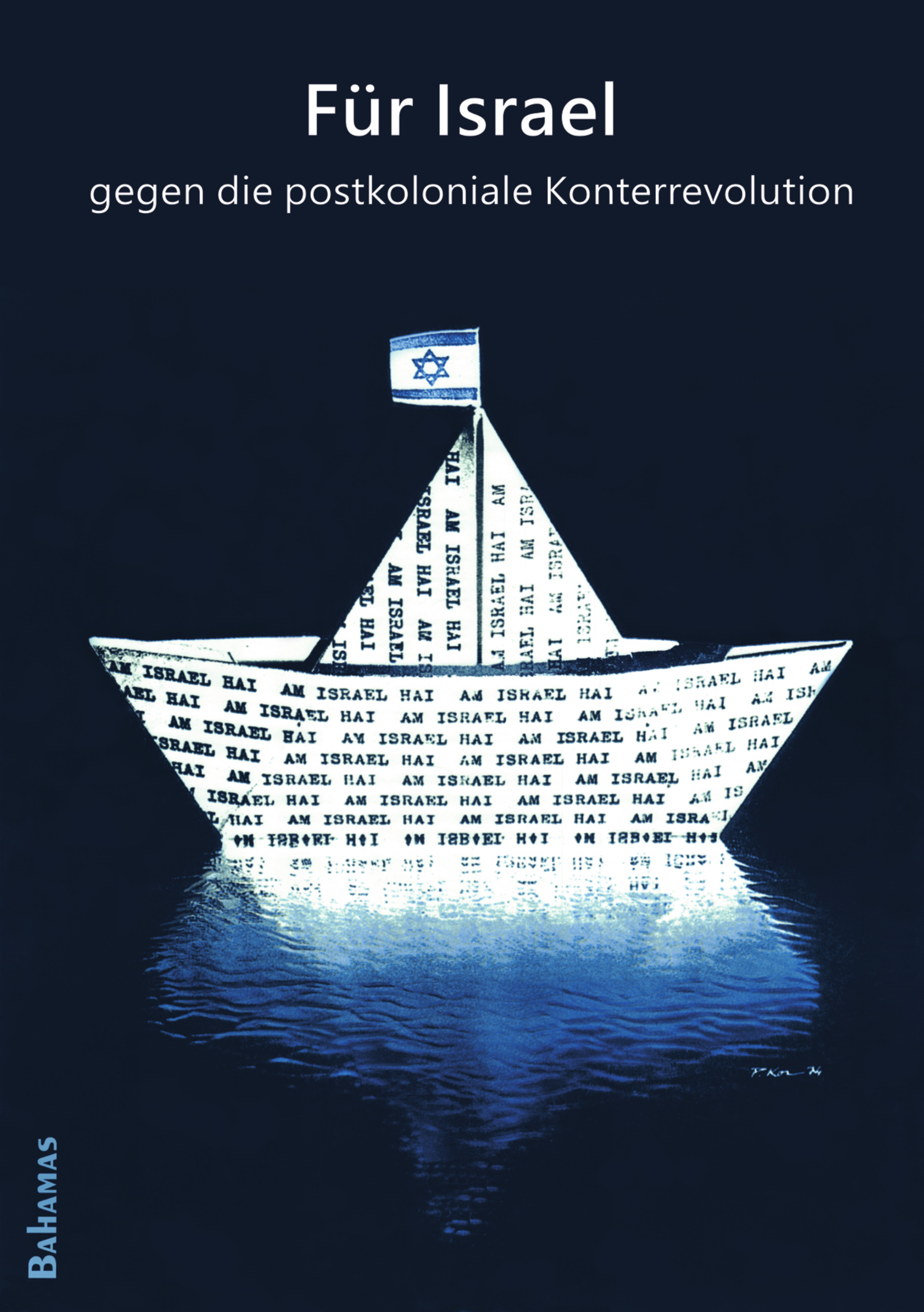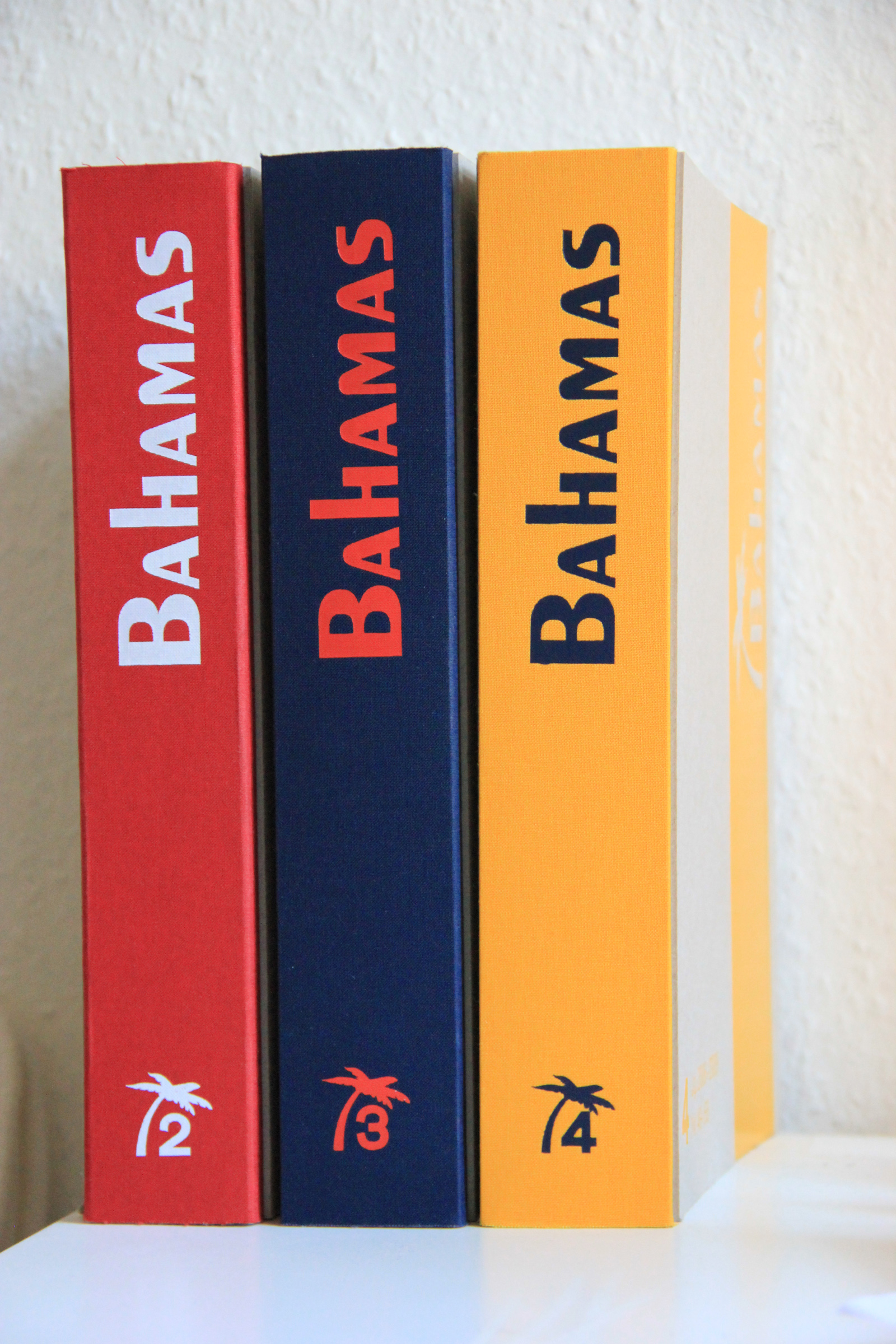Islamo-Gauchisme
Bericht einer toxischen Liebesbeziehung
Im Februar 2021 brachte die französische Hochschulministerin Frédérique Vidal das von Pierre-André Taguieff 2002 erstmals eingeführte Wortpaar Islamo-Gauchisme zufällig zurück in die öffentliche Diskussion. Der vor allem durch seine Arbeiten über den französischen Rechtsextremismus und Rassismus bekannt gewordene Taguieff benannte damit vor über 20 Jahren „die Konvergenz, um nicht zu sagen die militante Allianz zwischen den linksradikalen Strömungen und islamistischen Bewegungen im Namen der palästinensischen Sache, die zum großen revolutionären Zweck erhoben wurde“. (1) Vor Augen stand ihm dabei die gemeinsame Mobilisierung im Zuge der zweiten Intifada, bei der sich die Linke weder an „Allahu akbar“-Rufen noch am Aufruf zur Zerstörung Israels störte, weil sie einem gnostischen, globalisierten Antizionismus anhänge, „der als Heilsmethode und Erlösungsversprechen fungiert – Israel zerstören, um die Menschheit zu retten“. (2)
Während einer Talkshow, in der Vidal über den Laizismus debattierte, äußerte der Moderator Jean-Pierre Elkabbach den Verdacht, an französischen Universitäten materialisiere sich ein Bündnis zwischen Mao Tse-Tung und Ajatollah Khomeini. „Sie haben völlig recht“, erwiderte die Ministerin. Vidal brandmarkte die politische Linke realitätsgerecht als nützliche Idioten der Jihadisten und versprach, eine Untersuchung über den verheerenden Einfluss des Islamo-Gauchisme an den Universitäten zu initiieren. Erwartbar reagierten die damit Kritisierten: Sie verwarfen das Ganze als leicht durchschaubares wahltaktisches Manöver, um die Wähler der extremen Rechten zu gewinnen. „Sie bestreiten, dass auch nur etwas dieser Allianz Ähnelndes zwischen der Linken und den Islamisten existiert. Sie sagen, es handle sich um eine Illusion, die vom politischen Gegner gepflegt werde“, (3) fasste Sir John Jenkins die linke Reaktion auf die Offenlegung des Offensichtlichen kompakt zusammen. Für den ehemalige Diplomaten teilen Linke und die islamischen Bewegungen ein weit über bloße Taktik hinausgehendes gemeinsames Weltbild, das sich in der Opposition gegen die moderne liberale und demokratische Ordnung ausdrückt und in der gemeinsamen Feindschaft gegen Israel und die Juden kulminiert. Praktisch manifestiert sich dieses Bündnis derzeit wöchentlich in Form von antizionistischen Massenaufmärschen in westlichen Großstädten, doch bereits 1978 schwärmte Michel Foucault in seinen Berichten über die sich anbahnende islamische Revolution im Iran von Ali Shariati, der während seiner Studienzeit in Frankreich die Nähe zur christlichen Linken und nicht-marxistischen Sozialisten gesucht habe und dessen Name „bei Großdemonstrationen in Teheran neben dem Khomenynis [sic] gerufen wurde“. (4) Shariati, der führende ideologische Wegbereiter der Islamischen Republik, gilt fälschlicherweise als jemand, der Marx und den Islam synthetisierte, dabei stellte er unmissverständlich fest: „Islam und Marxismus erweisen sich in allen Bereichen der Politik, der Ökonomie, der Ethik und der sozialen Anliegen als völlig inkompatibel.“ (5) Der Marxismus, der auf einem gottlosen Materialismus fuße, teile nach Shariati alle Fehler des Westens, aus dem er entstammt. Andere, wie etwa Judith Butler, gingen sogar noch einen Schritt weiter und erklärten Hamas und Hisbollah aufgrund ihres anti-imperialistischen Charakters gleich der globalen Linken zugehörig. Eine steile These, die unfreiwillig den zeitgenössischen Charakter der Linken entblößt und die postmoderne Vordenkerin eigentlich auch zur Neubewertung des Nationalsozialismus treiben müsste: Laut dem Historiker David Motadel war Berlin in der Zeit des Zweiten Weltkriegs ein „Zentrum des antiimperial-revolutionären Aktivismus“, (6) das antikoloniale Führer aus Indien, der arabischen Halbinsel, Irland und Zentralasien anzog. Sicher auch vom Antiimperialismus angezogen fühlten sich vor knapp 10 Jahren Peter Schäfer und Tanja Tabbara, die in einer Broschüre für die Rosa-Luxemburg-Stiftung für den kritischen Dialog mit moderaten Vertretern des politischen Islams eintraten, wofür sie in Karim Sadek einen Gesprächspartner fanden, der ihnen zu diesem Zweck die tunesischen Muslimbrüder schmackhaft machte. Ihre auf Selbstaufgabe zielende Stoßrichtung legitimierten sie damit, „dass moderate islamistische Akteure und Linke gerade in Fragen sozialer Gerechtigkeit durchaus gemeinsame Werte haben, auf deren Basis ein kritischer Dialog möglich ist.“ (7)
Weil Vidal in Frankreich mit ihrer beiläufigen Bemerkung über das linksislamische Bündnis ins Schwarze traf, fiel die Gegenreaktion dort heftig aus. Die von der Hochschulministerin angedachten Maßnahmen seien Ausdruck einer Gesinnungspolizei, zeterte Jean-Luc Mélenchon, Großmufti der islamlinken Bewegung La France insoumise, die unter dem Banner Palästinas das Bündnis einer abstiegsgefährdeten Mittelklasse mit den Stichwortgebern des Islam und seinen lumpenproletarischen Fußtruppen vollzieht. Einer dieser Wortführer, Yasser Louati, der ehemalige Vorsitzende des dem europäischen Netzwerk der Muslimbrüder nahestehenden Collectif contre l’Islamophobie en France (CCIF), bot in seinem Beitrag im Berkley Forum der Georgetown University das ganze Arsenal postmodern-linker Worthülsen auf, um den Begriff Islamo-Gauchisme als wissenschaftlich widerlegten Kampfbegriff zum Zwecke der Verschwörung des farbenblinden und deshalb weißen Frankreichs gegen die Kolonisierten zu brandmarken. Taguieffs Theorie und Begriff gewännen aktuell wieder an Zugkraft, „weil sie zur mächtigsten Waffe gegen die linke Kritik an der Islamophobie, der israelischen Okkupation oder dem Kolonialismus wurde(n).“ (8) Die Profiteure und Handlanger des Status Quo führten die Wortkreation zuvorderst gegen jede wirklich systemkritische Linke ins Feld und legten damit die rechtsextreme Hegemonie in Frankreich offen.
Erklärungsbedürftig ist nicht, ob ein solches Bündnis besteht – das tut es zu offensichtlich, und die den Islam und die Linke verbindenden Elemente sind längst zahlreich beschrieben. Es bleibt aber die Frage, welche der Gesellschaft entspringenden Triebkräfte Bedürfnisse hervorbrachten, die diese Konvergenz ermöglichten.
Von Gespenstern und Arbeitern
Aller gegenteiliger Evidenz zum Trotz ist für den Taz-Korrespondent Rudolf Balmer der Islamo-Gauchisme lediglich ein über die universitären Korridore schwebendes Gespenst, womit er bemüht an den berühmten Satz von Karl Marx aus dem Kommunistischen Manifest anknüpft. (9) Die Intention der von Marx verfassten, zutiefst westlichen Schrift, die die Errungenschaften der Bourgeoisie preist, die „alle chinesischen Mauern in den Grund schießt, (die) den hartnäckigsten Fremdenhaß der Barbaren zur Kapitulation zwingt […] und sich eine Welt nach ihrem Bilde“ (10) schafft, war es, die gespenstische Formlosigkeit des Kommunismus durch eine Programmschrift zu beenden. In den interessengeleiteten Aktionen der sich formierenden europäischen Arbeiterklasse erkannte Marx einen immanenten Widerspruch der kapitalistischen Verhältnisse, der mithilfe einer kommunistischen Partei revolutionär aufzulösen sei. Entgegen der dort formulierten Hoffnung kam es durch das Bündnis zwischen der nach materieller Besserung trachtenden Arbeiterklasse und kommunistischen Intellektuellen zwar nicht zur Aufhebung der Verhältnisse zu einem die Potenzialität der Reichtumsproduktion realisierenden Verein freier Menschen. Jedoch entstand eine lange Zeit als naturnotwendig erachtete Verbindung, die sozialdemokratischen und zu geringerem Maß auch kommunistischen Parteien bis weit ins 20. Jahrhundert eine treue Wählerschaft bescherte. Mit dem Ende des Fordismus ging diese zu Bruch. Unter großem Getöse verabschiedeten sich linke Intellektuelle ab den 1970ern von der nun immer mehr politisch und ökonomisch unter Druck geratenden Arbeiterklasse – unter anderem deshalb, weil die Arbeiter sich für den Geschmack der Intellektuellen allzu leicht durch Lohnerhöhungen vom Ziel der Revolution abbringen ließen. Dem gingen mehrere miteinander verknüpfte Ereignisse voran. Die zur Lösung der Profitabilitätskrise im roten Jahrzehnt (1967–1977) begonnene Verlagerung der Produktion in den globalen Süden schwächte die Arbeiterklasse nicht nur numerisch, sondern verschlechterte auch ihre Verhandlungsposition im Westen. Gleichzeitig war die aufkommende Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft dazu angehalten, mehr Menschen der mittleren und höheren Bildung zuzuführen. Dies ließ eine zwar lohnabhängige, jedoch nicht wertproduzierende neue Mittelklasse auf ein bis dahin unbekanntes Maß anwachsen, deren Interessen jenen der Arbeiter diametral entgegenstand und die beginnend mit den 1980ern die Basis der linken Parteien bildeten und den Großteil ihrer Funktionäre stellte. Bei der Suche nach einem neuen revolutionären Subjekt trafen linke Sinnsuchende neben allerlei die herrschenden Verhältnisse vermeintlich in Frage stellenden Minderheiten auch auf wackere Kämpfer in der Dritten Welt, denen die zivilisatorischen Hemmungen der Arbeiterklasse abgingen, weshalb man hoffte, sie statt dieser für den Sozialismus zu gewinnen.
Die Ursprünge des Islamo-Gauchisme
Bereits 1994 legte dann der Trotzkist Chris Harman ein Pamphlet vor, das Pascal Bruckner oder Spiked-Redakteur Tom Slater als Gründungsmanifest einer rot-grünen Allianz gilt. Das ehemalige Mitglied des ZK der Socialist Workers Party, in der sich mit Kenan Malik in den 1980ern auch ein avancierter Kritiker der linken Identitätspolitik tummelte, hielt in seiner Schrift zumindest auf der Ebene der Darstellung an einem gewissen Wahrheitsanspruch fest. Daraus zog er zwar falsche, jedoch nach seinem dem marxistischen Denken des 19. und frühen 20. Jahrhundert entsprungenen Weltbild folgerichtige Schlüsse. Fernab jeder Sympathie für den Islam schrieb Harman gegen eine damals noch nicht völlig wahnhafte Linke an, die im Islamismus aufgrund seiner Klassenstruktur, dem Hass auf die Linke und der Verachtung der Frau eine Spielart des Faschismus erkannte und sich deshalb „mit der „liberalen Bourgeoisie“ als Gegengewicht zu den „reaktionären Ideen“ des Islam verbündete. Gleichzeitig sparte Harman nicht mit Kritik an jenen, die sich „die islamistische Bewegung als eine „progressive“, „antiimperialistische“ Bewegung der Unterdrückten“ (11) zurechtlügten. Diesen islamischen Erneuerungsbewegungen attestierte Harman ungeschönt, dass sie „Frauen die Schleier aufzwingen, die Gedankenfreiheit mit Terror unterdrücken und mit barbarischsten Strafen drohen für den Fall, dass man ihren Gesetzen trotzen sollte.“ (12) Selbst als Bündnispartner gegen den Imperialismus konnte er ihnen nichts Positives abgewinnen: „Solche Bewegungen tragen zur Verwirrung bei, indem sie sich abwenden von jedem realen Kampf gegen den Imperialismus und an seine Stelle den rein ideologischen Streit gegen seine vermeintlichen kulturellen Auswirkungen setzen.“ Schlimmer noch, sie mobilisieren den Hass gegen „all jene, die ‚fremde‘ Sprachen sprechen, ‚fremdländische‘ Religionen akzeptieren oder die ‚traditionelle‘ Lebensweisen ablehnen“, und dies „deckt sich auch mit den unmittelbaren materiellen Interessen mancher Sektoren der Mittelschichten, die leichter ihre eigenen Karrieren fördern können, indem sie andere aus ihren Jobs vertreiben.“ (13) Klassensoziologisch lokalisiert Harman den Ursprung des „Islamismus mit seinem Projekt der Wiedererrichtung einer Gesellschaft nach dem Modell Mohammeds des Arabiens des 7. Jahrhunderts“ in der „verarmten Sektion der neuen Mittelschicht“. (14) Diese Suche nach dem Heil in der Vergangenheit entspringt nun weder ausschließlich einem islamischen Spezifikum, auch wenn darin schon viel angelegt ist, noch ist dies leichtfertig als lediglich gedankliche Verirrung abzutun.
Die Bahn des Fortschritts bringt es mit sich, „daß Menschengruppen depossediert werden, die andererseits ihrem Ursprung und ihrer Ideologie nach durchaus in den Bereich der bürgerlichen Gesellschaft hineingehören und die nun aber plötzlich die materielle Basis eben dieser bürgerlichen Existenz verlieren“, (15) merkt Adorno in einer Vorlesung zur Einführung in die Dialektik an. Er nimmt dabei Bezug auf die außerordentliche Rolle, die das Kleinbürgertum bei der Herausbildung des Faschismus spielte. Jene also, die „ein materiell oder ideologisch besseres Leben kennen oder zumindest als Möglichkeit“ erfuhren, jedoch vom Fortgang der kapitalistischen Verhältnisse nichts Gutes für sich zu erwarten haben, weil es sie ökonomisch unter Druck setzt, flüchten sich in utopische Bilder des längst Vergangenen. Die damaligen Kleinbürger fühlten sich den Herrschenden zugehörig, die Tendenz des Kapitals zur Zentralisation degradierte sie jedoch zu Subalternen. Deshalb sehnten sie sich nach den für sie vorteilhaften Verhältnissen der idealisierten Vergangenheit, die sie für die Ursprungsmythen der Nationalsozialisten anfällig machte. Dieser von einer sich im Wartestand wähnenden Elite vertretene Antikapitalismus fühlt sich von den Verhältnissen um die Herrschaft über andere betrogen.
Die Linke konstituiert sich heute fast ausschließlich aus der akademischen Mittelklasse. Sie entstammt einer Gesellschaftsklasse, die Kritiker der Verhältnisse mit vielen Namen belegten. Marx sprach von der „dritten Person“, Nicos Poulantzas versuchte das Phänomen mit der Bezeichnung des neuen Kleinbürgertums zu fassen und Barbara Ehrenreich beschrieb in den 1970ern die Professional-Managerial Class. An Marx anschließend analysierte Henryk Grossmann sie als eine Klasse, die zwar auf der Basis der kapitalistischen Produktionsweise existiert, jedoch weder mittelbar noch unmittelbar an der Produktion beteiligt ist, was sie auf Grundlage der bestehenden Verhältnisse zu einer unproduktiven Klasse macht, die notwendig die Quelle der Akkumulation vermindert. Egal, wie man nun die Leistung dieser Klasse für das Funktionieren der Gesellschaft einschätzt, wo sie „zahlreich ist, wird ein großer Teil des gesellschaftlichen Produkts auf sie übertragen, daher der Akkumulationskoeffizient verkleinert, somit die Zusammenbruchstendenz verschärft.“ (16) Die Verhältnisse, die ab den 1960ern auf eine Ausweitung der höheren Bildung drängten, um den Ansprüchen einer Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft zu genügen, verwehren den Angehörigen dieser neuen Mittelklasse nun jedoch die versprochene Partizipation an der Herrschaft. In Krisenzeiten verschärft sich deren Lage sogar noch, denn die „Zusammenbruchstendenz könnte durch die Verminderung dieser Personenzahl abgeschwächt werden.“ (17) Darauf zielten die von Elon Musk angestoßenen Einsparungsmaßnahmen im amerikanischen Staatswesen ab, die als kultureller Kampf gegen die Wokeness erschienen, aber stringent der Verwertungslogik des Kapitals folgten. Um die Profitabilität des Kapitals zu gewährleisten, spart der Staat nun bei staatlichen und halbstaatlichen Ideologien und Sozialfunktionären ein, was diese nicht nur in den USA, sondern im gesamten Westen zunehmend in Berufe drängt, die sie als unwürdig erachten und sie vom Zentrum der Macht entfernen. Hier berühren sich die linke und islamische Enttäuschung darüber, die qua Bildungsabschlüssen oder Allah verbürgte Herrschaft über andere nicht antreten zu können. Deshalb schließen sie sich den „stärksten gesellschaftlichen Mächten an, die ihrerseits den üblichen Begriff des Fortschritts negieren“, (18) der mit Liberalität und individueller Freiheit notwendig verbunden ist, und landeten im Westen erst in der den Fortschritt und Luxus verachtenden Klimabewegung und kurz darauf in der sich für die Mordbrennerei des Islam begeisternden Palästinasolidarität.
Fortschritt und Regression
Die Idee des Fortschritts drängte sich den Menschen erst im Zeitalter der heraufziehenden kapitalistischen Produktionsweise auf. Diese fußte auf den Voraussetzungen der mittelalterlichen Christenheit mit ihrem Schutz des Privateigentums und dem Lob der Arbeit. Gleichzeitig brach sie revolutionär mit den die Produktivkräfte einengenden christlich legitimierten Verhältnissen, um sich zum Zivilisationszusammenhang des Westens zu transformieren. Geschichte entfloh der zyklischen Statik und folgte auch keiner Vorsehung mehr, sondern erschien als Produkt des Menschen: „So blieb die Form des Geschichtsprozesses der Gestalt göttlicher Verheißung verhaftet, auch wenn sich der ‚Finger Gottes‘ in die Metapher von der ‚unsichtbaren Hand‘ verwandelte. Eschatologie wurde zur Geschichte. […] Diese Vorstellung von der Zukunft sollte sich später in der Idee vom ‚Fortschritt‘ niederschlagen.“ (19) Als Träger der Fortschrittsidee betrat das revolutionäre Bürgertum die Bühne der Geschichte, um dem im Feudalismus herrschenden stationären Zustand zu opponieren. Den feudalen Fesseln entledigt stieß die bürgerliche Gesellschaft bereits im 19. Jahrhundert an ihre sich durch die Logik der Wertproduktion selbst gesetzten Grenzen, „sie konnte ihre eigene Vernunft, ihre eigenen Ideale von Freiheit, Gerechtigkeit und humaner Unmittelbarkeit nicht verwirklichen, ohne daß ihre Ordnung aufgehoben worden wäre.“ (20) Erst logen sich die Bürger das Versäumte als längst Realisiertes zurecht. Im nächsten Schritt gingen sie dazu über, den Fortschrittsglauben der ungebildeten und reformistischen Arbeiterbewegung zu geißeln, um sich im Zeitalter des Imperialismus schließlich ganz von den bürgerlichen Idealen zu verabschieden, was auch die Anfälligkeit für arische Ursprungsmythen oder zyklische Geschichtstheorien eines Oswald Spenglers zur Folge hatte, die an Ibn Khaldun gemahnten. (21) Dadurch blieb im europäischen Bürgertum vom einstigen Fortschrittsglauben vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs kaum noch etwas übrig.
Sowohl die Idee des Westens als auch jene des Fortschritts steht und fällt mit der sich vollziehenden ökonomischen Entwicklung. Nicht zufällig trat die den Fortschrittsglauben als totalitär zurückweisende postmoderne Theorie im Gefolge der Profitabilitätskrise der 1970er Jahre ihren Siegeszug in der Linken und den Universitäten an und verdrängte einen auf den roten Morgen hoffenden Marxismus, der seine Kraft aus den vorwärtstreibenden Verhältnissen der glorreichen 30 Nachkriegsjahre zog. Zur selben Zeit ereignete sich auch der Aufstieg der islamischen Erneuerungsbewegungen, die begannen, den arabischen Sozialismus zu überflügeln, den zumindest seine Vertreter noch als klassenübergreifendes Modernisierungsprojekt verstanden. Der arabische Sozialismus wies aufgrund der politökonomischen Verhältnisse im Nahen Osten und der dort fehlenden Arbeiterklasse so gut wie keine inhaltlichen Gemeinsamkeiten mit dem europäischen Sozialismus oder dem Marxismus auf, stattdessen fußte er auf der islamischen Soziallehre.
Unter den aktuellen Bedingungen einer aufgeschobenen Profitabilitätskrise, die die kapitalistische Produktionsweise in ein Stadium der Statik zwingt, florieren Ideen, die das aus der Tendenz des Kapitals unweigerlich Folgende ideologisch affirmieren und legitimieren. Der anti-westliche Antikapitalismus der Linken im Allgemeinen und der Klimabewegung im Besonderen richtet sich gegen das dynamische, in die Zukunft weisende Momentum der kapitalistischen Produktionsweise, das aktuell im Absterben begriffen ist und an das der Sozialismus, als immanente Kritik der bürgerlichen Gesellschaft, noch anschloss. Die kurzzeitige Konjunktur des Degrowth-Kommunismus erwies sich für viele Klimaaktivisten als ideologische Einstiegsdroge, die in einer insgeheimen und öffentlich vollzogenen Begeisterung für den als letzte Systemopposition erscheinenden Islam mündete. Dieser gewinnt heute seine Strahlkraft aus seinem statischen Charakter, der eine zur Freude der Klimabewegten zeitlich weit vor der Industrialisierung liegende anzustrebende Lebenswirklichkeit proklamiert, die nicht in jener Zeit liegt, „die sich auf einer Zeitachse als Zukunft erweist, sondern – scheinbar paradox – in der Vergangenheit. Nicht irgendeiner Vergangenheit, sondern in der idealen Zeit der Muslime – der nur wenige Jahrzehnte währenden Zeit seit der hijra, des im Jahr 622 erfolgten Auszugs des Propheten von Mekka nach Medina, bis zur 661 endenden Phase der vier rechtgeleiteten Kalifen.“ (22)
Revolutionäre im Wartestand
Parallel zum Westen schwollen auch im arabischen Raum die Mittelschichten durch den Ausbau der Bildungssysteme nach dem Zweiten Weltkrieg auf ein Niveau an, das vom Arbeitsmarkt kaum zu absorbieren war und eine mit den Verhältnissen unzufriedene, potentiell lohnabhänge, aber nicht wertproduzierende, neue Mittelklasse hervorbrachte. „Es sind nicht die Moscheen, sondern die Universitäten, die dem Islamismus wirklich den Rekrutierungsraum gewährleisten“. (23) Dies veranlasste Malik dazu, den radikalen Islam weniger als bloße Kontinuität eines in der Antike fußenden Glaubens zu sehen, sondern in ihm eine Reaktion auf den politischen und sozialen Wandel zu erkennen.
Ein sozialer Wandel anderer Art schwebte Harman vor über 30 Jahren bei seiner Analyse vor. In den Anhängern der islamischen Erneuerungsbewegungen erkannte er aufgrund der von Malik beschriebenen Antinomie eine Ambivalenz, die diese scheinbar für seinen Schmalspur-Sozialismus ansprechbar machten, der die Produktionssphäre und die in ihr stattfindende Wertproduktion naturalisiert, sie deshalb unangetastet lässt und lediglich eine Neuverteilung der Waren wünscht. Zwar konstatiert er, die „Klassenbasis des Islams ähnelt der des klassischen Faschismus“, denn all „diese Bewegungen haben ihre Mitgliederbasis unter Angestellten der Mittelschichten, unter Studenten sowie unter dem traditionellen handeltreibenden und berufstätigen Kleinbürgertum.“ (24) Doch auch die Jakobiner und der Peronismus wiesen diese Klassenzusammensetzung auf, beruhigt er seine auf den gedanklichen Umsturz drängenden Leser, und beginnt nun, sein dünnes revolutionäres Süppchen zu kochen. Denn nicht die Islamisten brachten die das globale Elend und den Imperialismus befeuernden Verhältnisse hervor, sondern die Kapitalisten. Dem jeder Erfahrung baren Marxismus des letzten Jahrhunderts verhaftet, der den Faschismus als ein in der Krise von Kapitalisten angewandtes Instrument analysiert, der ein verbittertes Kleinbürgertum aufwiegelt, um die Arbeiterbewegung zu zerschlagen, weist Harman den Faschismusvorwurf gegen den Islamismus zurück und attestiert seinen Anhängern eine für revolutionäre Zwecke brauchbare Ambivalenz. Auf ähnliche Gedanken wie Harman kam im Angesicht der gleichsam sozialrevolutionären wie anti-konservativen Mittelklassebewegung der Völkischen Ende des 19. Jahrhunderts auch die deutsche Sozialdemokratie. Hatte die Partei gegen den reaktionären und mit der alten Herrschaft verbandelten Antisemitismus eines Adolf Stoeckers und der mit ihm verbundenen Christlich-sozialen Partei noch klar Stellung bezogen, reagierten die Sozialisten auf „die Welle des radikalen, völkischen Antisemitismus Anfang der neunziger Jahre […] merkbar anders als auf die Stoeckerbewegung zehn Jahre früher. […] Eine der Hauptursachen dieser Wandlung mag darin gefunden werden, daß der völkische Antisemitismus einen ganz anderen Charakter hatte als sein konservatives Gegenstück, daß er ideologisch und politisch eine viel kompliziertere Erscheinung war.“ (25) Allgemein analysierten die Sozialisten den Antisemitismus als Konsequenz des Todeskampfs der Zwischenschichten, zu dem sie durch den Fortgang des Kapitalismus verurteilt seien. Nach langem Streit zwischen jenen, die die Mittelklasse als längst überkommen analysierten und deshalb wie Friedrich Engels glaubten, der Kapitalismus werde dieser und damit auch dem Antisemitismus den Todesstoß versetzen, und den eher auf die Gewinnung der Mittelklasse schielenden Parteifunktionären verabschiedete man auf dem Parteitag von 1896 eine Erklärung, die besagte, „daß die antisemitische Bewegung eine leidenschaftliche Reaktion gegen den Kapitalismus darstelle; sie richte sich irrtümlich gegen eine bestimmte Gruppe von Kapitalisten statt gegen das ganze kapitalistische System; sie sei im wesentlichen antikapitalistisch und daher potentiell revolutionär, wenn sie auch in einer unreifen Form von Rebellion auftrete, nichtig und lebensunfähig wie die Gruppen selbst, die ihr anhingen, gewissermaßen das Todesröcheln dahinsterbender Klassen.“ (26)
Über den auf Massenmord drängenden Judenhass der islamischen Erweckungsbewegungen, die wie der verstorbene Mitbegründer des Islamischen Jihad, Fathi al-Shiqaqi, in Israel ein zu zerstörendes Hindernis bei der Herstellung eines weltweiten Kalifats sehen, schweigt sich Harman im Text völlig aus. Auch wenn die sporadisch eingeworfenen Verurteilungen des jüdischen Staates als Siedlerkolonialismus im Vergleich zu heutigen linken Texten vergleichsweise zahm erscheinen, teilt Harman den Hass auf Israel mit den Ideologen des Islam. Denn den Wahn erkennt nicht, wer ihn selbst teilt. Auf eine Klassenanalyse fokussiert, die die Kritik der politischen Ökonomie ignoriert, erscheint ihm die im Islamismus aufblitzende Synthese aus Moderne und Ursprungsglaube als eine Bewegung, die sich in logisch unauflösbare Widersprüche verstrickt, daran notwendig scheitert und massenhaft Unzufriedene produziert, die sich dann dem Sozialismus anschließen. Die Anhänger der islamischen Erneuerungsbewegung ständen vor der Entscheidung, „einer vermeintlich goldenen Vergangenheit nach(zu)trauern, sie können aber auch begreifen, dass ihre Zukunft mit dem allgemeinen Fortschritt durch revolutionäre Veränderung verwoben ist.“ (27)
Die judenhassenden Anhänger eines weltweiten Kalifats, die ganz zur Freude bündnisbereiter Linker Reiche besteuern und für die Armen Almosen bereithalten, verwandeln sich so zu lediglich vom System Enttäuschten ohne eigene Agenda, die bisher dem Islam nur deshalb anhingen, weil sie die frohe Botschaft des Schmalspursozialismus noch nicht vernahmen. Unbeirrt und die aktuellen Kräfteverhältnisse ignorierend, in denen radikale Linke aufgrund gesellschaftlicher Irrelevanz höchstens als Wasserträger des islamischen Umbaus fungieren, folgert Harman unbeeindruckt, die Linke müsse in diesem antiimperialistischen Kampf die Führung übernehmen, was „ihr allerdings nur gelingen (wird), wenn sie sich absolut im Klaren darüber ist, wer der Hauptfeind ist und in welchem Verhältnis die islamistische Frage dazu steht.“ (28) Der Hauptfeind ist der Westen, weiß Harman, der die aktuelle Unterwerfung verschiedenster Marxisten unter den Islam als revolutionäre Tat veredelt. Innerhalb der globalen Linken ist jemand wie der Brite dennoch ein Auslaufmodell, zu sehr verwehrt er sich noch gegen den Islam und sieht ihn lediglich als Instrument zur Herstellung eines Sozialismus. Zwar ist im Zuge der antizionistischen Mobilisierung im Westen ein zahlenmäßiges Anwachsen trotzkistischer Gruppen zu verzeichnen, doch den Weg in die Hölle führen andere an.
Das säkulare links-islamische Bündnis
Exemplarisch für diese neue Linke steht der Öko-Leninist Andreas Malm, der sich im Unterschied zu Harman eine völlig von der Realität enthobene islamische Bewegung erdenkt, der er sich mit gutem Gewissen unterwirft, um, vom antizionistischen Erlösungsglauben angetrieben, gemeinsam in den antiimperialistischen Kampf gegen den Weltfeind Israel zu ziehen. Der durch seine Liebe zu gesprengten Pipelines und dem von ihm als Kriegskommunismus bezeichneten Massenverelendungsprogramm als Theoretiker des radikalen Flügels der Klimabewegung bekannt gewordene Schwede schwärmt in seinem neuesten Buch The Destruction of Palestine Is the Destruction of the Earth vom 7. Oktober, da er „die größte anti-koloniale Revolte des 21. Jahrhunderts“ gewesen sei. (29) Aus dem fernen New York spekuliert er lustvoll über die Möglichkeit, beim barbarischen Mordgeschäft zusammen mit den Genossen der „marxistischen“ PFLP selbst Hand anzulegen. Mit ihnen, so fantasiert er in seinem Buch, unterstelle er sich auch dem Kommando der Hamas und des Islamischen Jihad. Denn „jeder, der diese Bewegung (Hamas) verfolgt, kann bestätigen, dass sie sich fortwährend säkularisiert.“ (30) Wenig überraschend attestiert der Ideologe, der keine Lüge ausspricht, ohne sie nicht selbst zu glauben, der Hamas einen „Bruch mit dem verrückten und unentschuldbaren Antisemitismus der ersten Charta“ (31), die sie in Wahrheit nie zurücknahm. Die Feindschaft gegen den sich überlebten Antisemitismus meint Malm jedoch durchaus ernst, ist es doch ein Merkmal des sich an die Verhältnisse anpassenden Judenhasses, sich leidenschaftlich vom Vorgänger zu distanzieren und mit moralisch gutem Gewissen auf die Vernichtung zu drängen. Schon Willhelm Marr, einer der wichtigsten Stichwortgeber des Antisemitismus im 19. Jahrhundert, verurteilte den christlichen Antijudaismus und ging so weit, die Juden vor jeder religiösen Intoleranz in Schutz zu nehmen.
Tatsächlich publizierte die Hamas 2017 zum Wohlgefallen vieler Linker eine antiimperialistisch und postmodern-menschenrechtlich aufgepeppte Version ihrer Charta. Darin räumte sie neben der kriegerisch-jihadistischen Stoßrichtung auch die Option einer durch einen palästinensischen Volksentscheid legitimierten Zerstörung Israels ein. Folgerichtig treibt die „Islamische Widerstandsbewegung“ laut dem Klimaaktivist Malm seit ihrer angeblichen Loslösung von der Muslimbruderschaft auch gar nicht mehr die Geschlechtertrennung, der Kopftuchzwang und der islamischen Eifer um, sondern die von Malm geteilte Sache: die nationale Befreiung Palästinas. Das Ende der Zerstörung Gazas erklärt Malm zu einem ersten Schritt zur Errettung der Menschheit vorm Hitzetod, denn in Israel sieht er eine wesentliche Stütze des uns allen nach dem Leben trachtenden Fossil-Kapitalismus. Zur Legitimation dieses Irrsinns bedient er sich komplexer Konstruktionen, die die Anfänge der Kolonialisierung Palästinas ins Jahr 1840 verlegen und als Folge des Einsatzes des Dampfschiffes durch die Briten analysieren, die damals schon zur eigenen Herrschaftssicherung den Zionismus erfunden hätten, lange bevor dieser Ende des Jahrhunderts mit Theodor Herzl jüdisch geworden sei. Die Tatsache, dass der Iran und Katar, die maßgeblichen Geldgeber der Hamas und des Islamischen Jihad, einen Großteil ihrer Staatseinnahmen aus der Förderung von Erdöl und Gas lukrieren, nutzt Malm zu einem historischen Vergleich, der Israel zum Nazideutschland unserer Tage macht: „Das sind komplizierte Dinge, wie auch immer, die Umstände, die dazu führten, das Dritte Reich zu besiegen, resultierten teilweise aus dem Umstand, dass das stalinistische Regime so viel öl- und fossilgetriebene Maschinen zur Verfügung hatte. Es belieferte und unterstützte Partisanen in ganz Europa. Hier wurde fossile Energie für das Überleben und die Befreiung mobilisiert. Dies mindert nicht die negativen Auswirkungen der damit verbundenen Emissionen noch die des Booms der fossilen Brennstoffproduktion in Ost und West nach dem Zweiten Weltkrieg, aber ich glaube nicht, dass wir diese Mobilisierung wirklich bedauern können.“ (32) Darum plädiert Malm gar für eine Ausweitung der Zahlungen aus Katar und dem Iran für den islamischen Widerstand.
Das geklärt, empfiehlt der Öko-Leninist seinen Lesern, sich die Kommuniqués des Islamischen Jihads und der Hamas zu Gemüte zu führen. „Habt keine Angst, das sind großartige Inhalte. Hört rein, es enthält ganz wenig Religiöses, dafür sind die Botschaften voll beladen mit anti-kolonialer, anti-faschistischer Rhetorik“. (33) In Sachen Irrsinn steht Malms Verlagskollege Erik Skare dem nichts nach. Dessen auch im linken Verso-Verlag publiziertes Buch über den Islamismus in Gaza perfektioniert die Methode der Auslassung zum Zweck des Lügens mit der Wahrheit auf dem Niveau eines David Irving. Egal ob Weißbuch, Unabhängigkeitskrieg oder allgemein israelisches Handeln, überall stellt Skare lediglich dar, was der eigenen Stoßrichtung entgegenkommt. Gesprächiger wird er dagegen, wenn es um den Islamischen Jihad geht. Diese nach der Hamas zweitgrößte islamische Organisation in Gaza tut es dem Norweger besonders an; fasziniert berichtet er davon, wie deren Führungskader sich in den 1970ern in die antikoloniale Theorie der Linken einlasen, „die Führungsebene des Islamischen Jihads setzt sich aus jungen Palästinensern mit akademischen Abschlüssen in der Natur- und Geisteswissenschaft zusammen, ihr politisches Projekt war es auf verschiedenen Wegen Religiosität mit Modernität zu verbinden.“ (34) Darin erkennt er eine die Restebestände seines marxistischen Selbstbilds stützende Parallele zur Kommunistischen Partei Italien. „Natürlich, die Synthesis zwischen Tradition und Modernität ist dem Islamismus nichts Eigenes. Die Kommunistische Partei Italien in der Nachkriegszeit kombinierte zum Beispiel auch die Tradition der alten sozialistischen Bewegung mit der organisatorischen Effizienz des Leninismus und der moralischen Autorität der säkularen katholischen Kirche.“ (35) Mithilfe der Pippi-Langstrumpf-Methode konstruiert sich diese Linke eine islamische Bewegung zurecht, mit der sie eine einseitige Liebesheirat eingeht, um gemeinsam die Restbestände des Westens zu schleifen und in den heiligen Erlösungs-Krieg gegen Israel zu ziehen, das man sich als Feind der Menschheit und Ausfluss des absolut Bösen imaginiert, von dessen Zerstörung das Glück der Welt abhänge.
Für den Westen
Die radikale Gesellschaftskritik steht vor der schier unlösbaren Aufgabe, im Kampf gegen die islamlinke Barbarei zwar zu wissen, dass sie mit der Parteilichkeit für den Westen an eine Instanz appelliert, die unter krisenhaften Verhältnisse ihre Feinde massenhaft selbst produziert, an ihm jedoch notwendig festhalten und ihn verteidigen muss, weil mit seinem Untergang auch jeder Gedanke an eine befreite Gesellschaft verschwände, die sich die Kommunisten des 19. Jahrhunderts noch erhofften und die allein sein einmal angetretenes Projekt der auf Individualität fußenden Herstellung allgemeinen Reichtums und Glücks vollenden könnte. Von der Aufhebung der Verhältnisse ganz zu schweigen, ist es momentan schon um die Verteidigung des Westens nicht allzu gut bestellt. Vereinzelt blitzt sie noch in einzelnen Statements aus dem Umfeld der amerikanischen Regierung auf oder zeigt ihr Gesicht in losen Demonstrationen wie in London, die von jenen getragen werden, die als Arbeiter, Angestellte oder Kleinunternehmer von der auf die islamische Kumpanei abzielenden europäischen Politik die Schnauze voll haben und zu diesem Zweck den Union Jack und die Fahne des jüdischen Staates mitführen.
Michael Fischer (Bahamas 97 / 2025)
Anmerkungen:
- Pierre-André Taguieff: Das neue Opium der Progressiven. Radikaler Antizionismus und Islamo-Palästinismus, in Sanse Phrase 25, 2025, 81– 82
- ebd., 83
- John Atkins: Islamism and the Left, London 2021, 7
- Michel Foucault: Wovon träumen die Iraner? In Michel Foucault: Kritik des Regierens. Schriften zur Politik, Berlin 2010, 363
- Ali Shariati: Marxism and other Western Fallacies. An Islamic Critique, North Haleden 1980, 77
- David Motadel: The Global Authoritarian Moment and the Revolt against Empire, in American Historical Review 124, Oxford 2019, 843
- Peter Schäfer/Tanja Tabbara (Hg.): Dialog mit dem politischen Islam II, Berlin 2016, 4
- Yaser Louati: What Does Islamo-Gauchisme Mean for the Future of France and Democracy? https://berkleycenter.georgetown.edu/responses/what-does-islamo-gauchisme-mean-for-the-future-of-france-and-democracy
- Rudolf Balmer: Der Feind steht in der Uni, https://taz.de/Debatte-ueber-Islamo-Gauchismo-in-Frankreich/!5752291/
- Karl Marx: Manifest der Kommunistischen Partei, Stuttgart 2005, 24
- Chris Harman: Der Prophet und das Proletariat, www.marxists.org/deutsch/archiv/harman/1994/prophet/text.html
- ebd.
- ebd.
- ebd.
- Theodor W. Adorno: Einführung in die Dialektik, Berlin 2015, 205
- Henryk Grossmann: Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems, Frankfurt 1967, 360
- ebd., 361
- Adorno: Dialektik, 206
- Dan Diner: Versiegelte Zeit. Über den Stillstand in der islamischen Welt, Berlin 2007, 231
- Theodor W. Adorno: Fortschritt, in Kultur und Gesellschaftskritik II, Frankfurt 2003, 630
- Dieser vertrat im 14. Jahrhundert ein zyklisches Geschichtsbild, in dem lediglich die Herrschaft nach dem immer gleichen Muster wechselte. Eine kämpferische islamische Kriegerkaste rebellierte gegen die als unislamisch erachtete städtische Herrschaft, setzte sich stattdessen an ihre Stelle und unterlag ihrerseits dem Prozess der Verstädterung, gegen den sie ursprünglich opponierte. Der Kreislauf begann erneut.
- Diner: Versiegelte Zeit, 238, Hervorh. im Orig.
- Kenan Malik: From Fatwa to Jihad, London 2017, 24
- Harman: Prophet, siehe Anm. 11
- Paul W. Massing: Vorgeschichte des politischen Antisemitismus, Hamburg 2021 [E-Book]
- ebd.
- Harman: Prophet, siehe Anm. 11
- ebd.
- Andreas Malm: The Destruction of Palestine Is the Destruction of the Earth, New York/London 2024, 89
- ebd., 90
- ebd., 90
- ebd., 82
- ebd., 91
- Erik Skare: Road to 7 Oktober. A Brief History of Palestinian Islamism, London 2025, 96
- ebd., 97
SPALTE3-AKTUELL-RUBRIK
Frühere Aktivitäten sind im Aktuell-Archiv aufgeführt. Dort gibt es auch einige Audio-Aufnahmen.
Alle bisher erschienenen Ausgaben der Bahamas finden Sie im Heft-Archiv jeweils mit Inhaltsverzeichnis, Editorial und drei online lesbaren Artikeln.