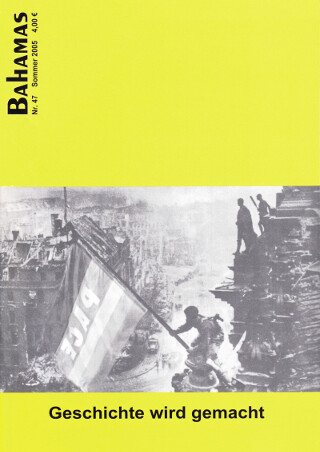Der Mufti of Marxism
Wie die Israelsolidarität den „gemäßigten Islamismus“ entdeckte
„Gegenwärtig verkörpert die muslimische Welt das Anderssein schlechthin. Der Islam wird als homogene und geschichtslose ‚Kultur‘ verstanden, die sich durch vormoderne und rückwärtsgewandte Vorstellungen auszeichne und ihre extremste Ausformung im religiösen Fanatismus, dem Islamismus, fände. Dadurch stehe diese ‚Kultur‘ mit anderen in einem unüberwindlichen Gegensatz. Wird der Islamismus aus der Religion – die wahlweise auch ‚Kultur‘ genannt wird – abgeleitet und damit aus seinem gesellschaftlichen Kontext gerissen, verkennt man dessen politische Dimension.“(1) Diese Einschätzung der Weltlage ist nicht etwa einem Propagandaheft der Bundeszentrale für politische Bildung entnommen und auch nicht dem Zentralorgan der deutschen Konvertiten, der Islamischen Zeitung, sondern dem Programm für die Konferenz „Feindbild Westen“, die im November 2004 in Berlin stattfand und zur Mobilisierung gegen den antisemitischen Islamistenaufmarsch am sogenannten Al-Quds-Tagbeitragen sollte. An dem an die Konferenz anschließenden Tag fand eine Protestkundgebung gegen den Al-Quds-Aufmarsch unter dem bezeichnenden Motto „Gegen Islamismus, Antisemitismus und Rassismus!“ statt. Der Umstand, daß ausgerechnet anläßlich einer jährlich stattfindenden und von den Behörden geduldeten, antijüdischen Manifestation bekennender Moslems behauptet wird, die „muslimische Welt“ verkörpere das „Anderssein schlechthin“, was auf die Unterstellung hinausläuft, die Moslems würden von Staatsorganen und der Bevölkerungsmehrheit zur Gegenrasse erklärt werden, wird in seiner ganzen Perfidie erst dann richtig begreifbar, wenn man weiß, daß die Anmelder von Demonstration und Konferenz sich ausdrücklich als mit Israel solidarische Kritiker des Antisemitismus und des Antizionismus verstehen.
In Wahrheit ging es nur darum, den Islam gegen sein schlechtes Image zu verteidigen. Seit dem 11. September 2001, das wissen inzwischen sogar deutsche Freunde des Dialogs der Kulturen, gilt es vor „den islamischen Fundamentalisten“ zu warnen, um einen vermeintlich guten, friedlichen und demokratiefähigen Islam zu bewerben. Die Gegnerschaft zu islamischer Barbarei findet nun, nachdem diese jahrzehntelang unter Denkverbot stand, im Zeichen zivilgesellschaftlicher Frontstellung gegen einige wenige irregeleitete Fanatiker statt, die nicht nur „unsere Demokratie“ und „unser multikulturelles Projekt“ in Frage stellten, sondern auch das Ansehen ihrer Kameraden aus der islamischen Kultur- und Religionsgemeinschaft schädigten. Gerade deshalb dürfe man keine pauschalen „Stigmatisierungen“ vornehmen, heißt es im Aufruf zur Konferenz gegen antiislamischen „Rassismus“. Soll heißen: Nicht nur alle gläubigen Moslems sind aus der Kritik zu nehmen, es verbietet sich auch, Islamisten pauschal zu verunglimpfen. Der Aufruf richtete sich folgerichtig nur gegen „radikalen Islamismus“. Solch zivilgesellschaftliches Engagement wurde dadurch belohnt, daß sich die Heinrich-Böll-Stiftung und die Friedrich-Ebert-Stiftung, die noch kurze Zeit zuvor auf einer Konferenz in Beirut den Dialog mit der Hizbullah gesucht hatte, umgehend in die Proteste einklinkten und als kleine Gegenleistung Redner für die Konferenz stellen durften.
Typisch Berlin, könnte man einwenden. Daß dort unter der Corporate Identity „gegen Antisemitismus“ ein ganzes Spektrum promovierender Geisteswissenschaftler wegen erhoffter späterer Beschäftigung im ideologischen Apparat hochmotivierte unentgeltliche Lobbyarbeit für die Staatsziele der Berliner Republik macht, ist bekannt und könnte als unangenehmes Hauptstadtphänomen abgetan werden. Mit Israelsolidarität im engeren Sinn habe das gar nichts zu tun, werden manche mutmaßen. Dort, wo sich die wirklich Solidarischen austauschen, auf der Israel-Solidaritäts-Mailingliste im Internet, auf Vernetzungstreffen wie im März in Frankfurt, in den einschlägigen meist kleinen Zeitschriften und entsprechenden Sammelbänden wären solche Positionen undenkbar – glaubt man. Dort habe doch nicht zuletzt wegen der Solidarität mit Israel scharfe Kritik am Islam einen festen und geachteten Platz und nicht berufsmäßige Schönredner des grünen Faschismus – hofft man.
Allein, es ist nicht so. In einer anderen deutschen Haupstadt lebt der Star dieses Aufsatzes, der seit Jahren solche Hoffnung zu Schanden werden läßt. Es ist der Wiener Thomas Schmidinger, der natürlich auch als Referent zu jener Konferenz eingeladen war. Als Herausgeber eines Buches beim Ça ira-Verlag und Mitglied der österreichischen Sektion des jedenfalls in Deutschland als proamerikanisch und islamkritisch bekannten Wadi e.V. müßte er doch eigentlich der dezidiert antideutscher Kritiker sein, als der er überall durchgeht. Doch im Vergleich zu den gesammelten Werken des Redakteurs der Zeitschrift Context XXI (2), die seit über sieben Jahren überall dort erscheinen, wo links und antirassistisch draufsteht, und manchmal auch dort, wo es ein bißchen völkisch zugeht, sehen selbst die Berliner Ausrichter einer Al-Quds-Konferenz zur Ehrenrettung des Islam blaß aus.
Daß Schmidinger sich im antirassistischen Jargon, den er konsequent an Stelle des leicht anrüchig gewordenen Vokabulars des ML-Antiimperialismus früherer Jahre pflegt, als Verfechter einer vorgeblich gründlich differenzierenden Israel-Solidarität in Szene setzen kann, ist schon erstaunlich genug. Daß er damit zugleich ganz unverhohlen mit den ärgsten Feinden des jüdischen Staates im Bunde ist, sie hofiert, ihre Aussagen schönredet, ihre Intentionen verniedlicht, ohne daß es in der israelsolidarischen Szene kräftig gescheppert hätte, ist Grund zur Skandalisierung wie auch zu der befremdeten Nachfrage: Wie konnte das möglich sein?
Fanatismen auf beiden Seiten
Ein Freund Israels erklärt die Welt: Die „Vertreibung großer Teile der arabischen Bevölkerung Palästinas“ sei der Grund dafür, daß österreichische und deutsche Antisemiten nun leicht arabische Verbündete fänden.(3) Der militante Antisemitismus der Palästinenser sei „eine Folge des Nahostkonflikts, nicht seine Ursache“. (Jungle World 48/01) Ebenfalls eine bloße Folge seien die Selbstmordanschläge der Hamas während der Regierungszeit Benjamin Netanjahus seit 1996 gewesen, schließlich habe sie damit auf die Siedlungspolitik „geantwortet“, mit der Netanjahu sie „provoziert“ habe.(4) Damals fragte sich Schmidinger besorgt, „wie lange die Geduld der palästinensischen Bevölkerung nach den Enttäuschungen der Ära Netanjahu noch ausreicht“ (ebd.). Auf Seiten der Ungeduldigen stehend, fand er Antworten bei der „palästinensischen Linken“, konkret bei der „linken Opposition in der PLO und in den besetzten Gebieten“, über die er eine ganze Abhandlung geschrieben hat. Alles stand damals schon, lange vor Gründung der Zeitschrift gleichen Namens, in einem größeren Kontext: „In den meisten Staaten des Trikont haben am Ende der Kolonialzeit insbesondere antikapitalistische Gruppierungen den – vielfach auch bewaffneten – Kampf mit den Kolonialherren aufgenommen.“(5) Über den schon damals beträchtlichen islamischen Anteil am sogenannten „Antikapitalismus“, den er vom „Antikolonialsimus“ nicht unterscheiden will, schweigt sich Schmidinger aus. Ihm geht es um die Guten – und das sind die Befreiungsnationalisten: „Formen des Nationalismus (sind) in den meisten Staaten des Südens“ ein „integraler Bestandteil revolutionärer und linker Gruppierungen geblieben, während sich konservative Regierungen immer wieder zu Handlangern Europäischer und Nordamerikanischer Kapitalinteressen machten und machen“. (ebd.) Einer ihrer Vertreter ist Yassir Arafat, dessen Oslo-Politik Schmidinger als Kapitulation vor Israel geißelt und dessen Staatsprojekt er, wie sonst nur Werner Pirker in der Jungen Welt, mit der Schaffung der „Bantustans Südafrikas“ vergleicht (ebd.). Nicht erst mit dem Wye-Abkommen (1998) habe sich Arafat, wie Schmidinger zustimmend Gerrit Hoekmann zitiert, zu einem „Erfüllungsgehilfen israelischer Interessen“ gemacht.(6) Schon 1987/88, als „die gemäßigte Führungsspitze um Yassir Arafat“ bei Verhandlungen auf israelische Forderungen einging, sei sie zurecht „heftigen Angriffen durch die Opposition“ ausgesetzt gewesen. (ebd.) Anders als die PLO, deren Feindschaft gegen Israel offenbar nicht radikal genug gewesen sei, ist der „palästinensischen Linken“ deshalb der Vorzug zu geben, weil „insbesondere in Palästina und unter den ExilpalästinenserInnen progressive gesellschaftspolitische Vorstellungen und Antikapitalismus beinahe ausnahmslos mit Nationalismus und Panarabismus verbunden“ seien.(7) Schmidinger bringt natürlich Verständnis dafür auf, daß „die PalästinenserInnen nach der von ihnen als Nakba (Katastrophe) bezeichneten Flucht oder Vertreibung nicht fähig“ waren, „sich in die Opfer der Shoah hineinzuversetzen. (...) Da kaum ein israelischer Politiker nach 1948 darauf verzichtete, die Shoah als Begründung für die Existenz Israels anzuführen, kamen viele Palästinenser auf die Idee, daß es ihnen nützen könnte, eben die Shoah zu verschweigen oder als israelischen Propagandatrick zu bezeichnen und in Frage zu stellen. In diesem Zusammenhang fand nach 1948 der Antisemitismus in den arabischen Staaten größere Verbreitung.“ (Jungle World 48/01) Allerdings ist es nicht schön, Israelis zu ermorden und die Shoah zu leugnen. Wenn man es dagegen schafft, sich „in die Opfer der Shoah hineinzuversetzen“ bevor man israelische Jugendliche vor der Disko in die Luft sprengt, sieht die Sache schon ganz anders aus. Solcher Logik folgend, lobt Schmidinger die Antizionisten Edward Said und Azmi Bishara, die beide wiederholt Selbstmordattentate gerechtfertigt haben, allen Ernstes als arabische „Gegenstimmen“ wider den Antisemitismus, weil sie sich gegen die Holocaustleugnung ausgesprochen haben (ebd.) Beide hätten darüber hinaus den „Ausweg aus dem Dilemma nationalistischer und religiöser Fanatismen auf beiden Seiten“ gefunden.(8) Worin sonst könnte solcher Ausweg bestehen als in der etwa von Said und Bishara immer wieder erhobenen Forderung nach einem „binationalen Staat“, die Schmidinger ausdrücklich gutheißt? Daß mit dessen Etablierung Israel seine Schutzfunktion für die eigenen jüdischen Staatsbürger und darüber hinaus für die Juden weltweit verlieren und sich in ein weiteres Aufmarschgebiet des Islamismus verwandeln würde, hat Schmidinger zwei Monate nach 9/11, als der Artikel erschien, nicht interessiert.
Der „sozial-revolutionäre“ Islam
Kaum anders als die arabischen Nationalisten selbst, mußte auch Schmidinger feststellen, daß revolutionäre Potentiale im Volke existieren, die weit älter als die Nationalstaatsidee sind und bisher nie ausreichend berücksichtigt wurden. In seinem neuen Buch „Irak. Von der Republik der Angst zur bürgerlichen Demokratie“, das peinlicherweise 2004 im Ça ira-Verlag erschienen ist und von den Herausgebern damit beworben wurde, es kämen „gemäßigte Islamisten“ zu Wort, entdeckt Schmidinger den Islam als sozialrevolutionäre Religion. Er feiert den schiitischen Islam „als religiöse Richtung der Entrechteten und Unterdrückten“, die mit einem „gewissen sozialrevolutionären Potenzial“ (S. 114) behaftet sei und „immer auch einen Aspekt des Subversiven und der Bedrohung der Herrschaft“ (S. 116) enthalte. Dieses Potential sei eine „Erinnerung“ an die ursprünglich, also wohl während der Herrschaft der rechtgeleiteten Kalifen, vorhandenen „sozialrevolutionären Aspekte des Islam“. (ebenda) Schmidinger führt nicht nur vor, wie man mitten in der antideutschen Szene Werbung für einen Islam von unten machen kann, dessen Scheußlichkeiten in Asien und Afrika überall zu offenbar sind, sondern bedient sich sogar der gleichen Argumente wie die Islamisten, die ja ebenfalls für einen ursprünglichen Islam schwärmen, der im Verlauf der Geschichte durch seinen Mißbrauch als Herrschaftsreligion verfälscht worden sei. Als Kronzeugen für seine romantisch verklärende Werbeveranstaltung für die Wiedererrichtung „naturwüchsiger Gesellschaft“ (Adorno) bietet der Wiener Marxist Karl Marx auf. Der habe Religion nicht nur als „Opium des Volkes“ kritisiert, sondern sie auch als „Seufzer der bedrängten Kreatur“ interpretiert. Marx hat die Religion tatsächlich als „Seufzer“ verworfen, weil sie keine kritische, an der Vernunft orientierte Reflexion ist. Aber noch der Hinweis auf schicksalsergebene und damit immerhin recht friedliche Seufzer der Unterdrückten bezog sich nicht auf die Religion, sondern auf eine bestimmte, nämlich das Christentum. Über den Islam schrieb Marx schon 1854 zutreffend: „Der Islam ächtet die Nation der Ungläubigen und schafft einen Zustand permanenter Feindschaft zwischen Muselmanen und Ungläubigen.“(9)
Im Bündnis mit Islamisten
Weil Schmidinger von der Faszination für den Islam gefesselt bleibt, ist es nur konsequent, wenn er das offene Bündnis mit Islamisten sucht, die genau dasselbe daherschwätzen, wie er. Bereits 1998 interviewte Schmidinger für die Zeitschrift International den „linken“ Muslimbruder Khalil Abd el-Karim. Dieser sei eine der„schillerndsten Figuren der Ägyptischen Linken.“(10) Nachdem el-Karim während der Repressionswelle Nassers gegen die Muslimbruderschaft ins Gefängnis gekommen und unter Sadat wieder aus der Haft entlassen worden war, habe der „,Red Scheikh‘ – wie er seither immer wieder tituliert wurde“ festgestellt, „dass die junge Generation der Muslimbrüder sich von den Idealen ihres 1949 ermordeten Gründers wegbewegt hatten und fand sich bei der linken Oppositionspartei Tagammu wieder. Seither gilt der ,Mufti of Marxism‘ – wie ihn seine konservativen GegnerInnen nennen – als ein Denker eines progressiven, sozialistischen Islam.“ Er versuche „armen Leuten zu ihrem Recht“ zu verhelfen. El-Karim gibt ganz ungeniert über die soziale Ader der Muslimbruderschaft Auskunft, die „von Anfang an sozialistisch“ gewesen sei. Schmidinger hat all dem nichts zu entgegnen. Im Gegenteil: Er warnt sogar noch davor, den Islam zum „Feindbild“ zu stilisieren. Nun könnte man einwenden, dieser Text aus dem Jahr 1998 sei schon ziemlich alt und Schmidinger habe sich eben in seinen Ansichten geändert, was ja durchaus möglich sein könnte, man hat angeblich auch schon Pferde kotzen sehen. Zwei Argumente sprechen jedoch gegen eine solche Annahme: Erstens ist das Interview immer noch auf der Homepage der Context XXI abrufbar, obwohl es jederzeit vom Autor gelöscht werden könnte. Zweitens hat sich an Schmidingers Begeisterung für „gemäßigte Islamisten“ rein gar nichts geändert, was aktuelle Beispiele verdeutlichen: Im Juli 2003 bot Wadi e.V. Wien, deren Mitglied Schmidinger ist, einem Vertreter des Obersten Rates der Islamischen Revolution im Irak (Sciri) die Gelegenheit, seine Ideologie auf einer Veranstaltung anzupreisen. In der Ausgabe 6–7/2004 der Context XXI bringt Thomas Schmidinger auch sudanesischen Islamisten Sympathien entgegen. Der Sprecher der Justice and Equality Movement (JEM) Deutschland, Mohammed Targoni, wird von ihm höchstpersönlich interviewt und darf seinen Verein als Befreiungsbewegung darstellen, der es um die Installierung eines demokratischen, säkularen Systems ginge. In dem Interview wird mit keiner Silbe erwähnt, daß die JEM dem Islamisten Hassan Al-Turabi nahe steht, daß der Vorsitzende der JEM gar Mitglied in Turabis National Islamic Front war. Die JEM ist derzeit bemüht, sich als säkulare und demokratische Kraft der Öffentlichkeit zu präsentieren, um das Bündnis mit der tatsächlich säkularen SLM/A zu suchen sowie den Einsatz von Blauhelmsoldaten nicht zu gefährden. Die deutsche Sektion der JEM verweist deshalb gern auf Menschen- und Völkerrecht, bezieht sich auf Stellungnahmen von amnesty international und hat sogar die Jungle World und die Context XXI auf ihrer Homepage verlinkt. Dennoch ist ihr islamistisches Wesen nur schlecht getarnt: Bereits auf der englischsprachigen Homepage findet sich unter dem Link „documents“ an oberster Stelle das sogenannte black book. Darin bekennt sich die JEM eindeutig zu einem islamischen Staat mit einer Gesetzgebung auf Grundlage der Scharia. Der islamistischen Regierung in Khartoum wirft sie lediglich vor, unislamisch zu handeln, weil sie nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sei. Schmidinger jedoch behauptet in den Blättern für deutsche und internationale Politik (2/05), „eine islamische oder gar islamistische Rhetorik“ sei „weder in den Erklärungen noch auf der Homepage der JEM zu finden.“
Der antikoloniale Blick
Die Behauptung, der Antisemitismus sei ein dem Islam völlig äußerliches Phänomen, spielt eine zentrale Rolle für Schmidingers antikolonial aufgeblasenen Antirassismus, der die „Völker“ und ihre „Kulturen“ gegen Verwestlichung schützen möchte. Der Westen taucht bei Thomas Schmidinger allein in Gestalt der „Kolonialmächte“ Großbritannien und Frankreich auf, die den Antisemitismus im Nahen Osten als Herrschaftsinstrument eingeführt hätten. In dieser antikolonialen Argumentation verschwinden nicht nur die Unterschiede zwischen dem im arabischen Raum nie kolonial aufgetretenen, dafür dezidiert antisemitischen Deutschland einerseits und Westeuropa andererseits, das zwar Kolonien und Mandate in der Region unterhielt, aber im Falle Großbritanniens nie und im Falle Frankreichs nach der Dreyfus-Affäre nicht mehr als Antisemitimusexporteure in Erscheinung getreten sind. Die vom Kolonialismus beherrschten Völker erscheinen als allein durch Notwehr zum Antisemitismus Getriebene. Der arabische Antisemitismus sei ein Exportprodukt aus dem Westen, „das je nach Bedarf für die Auseinandersetzung mit Israel eingesetzt wird“. Zwar habe es hin und wieder auch Verfolgungen von Juden unter islamischer Herrschaft gegeben, aber diese seien lediglich Teil „lokaler Machtkämpfe“ gewesen und hätten mit Antisemitismus nun wirklich nichts zu tun gehabt. Pogrome seien nur die „Ausnahme“ gewesen und würden an der Einschätzung des Islam als definitiv nicht antisemitischer Ideologie nichts ändern. „Eine spezifisch gegen Jüdinnen und Juden gerichtete Verschwörungstheorie“, so sein Fazit, „existierte in der islamischen Geschichte bis zum frühen 20. Jahrhundert (...) nicht.“ Deshalb nennt Schmidinger den islamischen Antisemitismus auch eine „Instrumentalisierung der Religion“. (Jungle World 48/01 und Phase 2 15/05) Sein ebenso plumpes wie für antiwestlich eingestellte Gemüter willkommenes Schema ist: Der Antisemitismus ist böse. Das Böse kommt aus dem Westen. Die Kultur, in deren Namen dieses Böse praktiziert wird, hat „eigentlich“ gar nichts mit ihm zu tun. Im Gegenteil: Sie bedient sich nur der ihr wesensfremden Mittel, die ihr der Westen aufgezwungen hat.
Islamischer Antisemitismus
Daß der islamische Antisemitismus sich auch aus europäischen Quellen speist, steht außer Frage, daß die antisemitischen Stereotypen allerdings in islamischen Gesellschaften solche Verbreitung finden konnten, läßt sich nicht erklären, wenn man annimmt, dem Islam sei die Judenfeindschaft grundsätzlich fremd. Vielmehr wäre zu konstatieren, daß der europäische Antisemitismus im Islam auf fruchtbaren Boden fiel, woraus sich auch seine heutige Intensität und Verbreitung unter Moslems erklärt. Liest man nur ein einziges Mal das große heilige Buch, den Koran, so ist unschwer zu erkennen, daß die von Schmidinger geleugnete spezifisch gegen Juden gerichtete Verschwörungstheorie bereits hier zu finden ist. Die Juden hätten den Propheten Jesus umgebracht heißt es da, sie seien Lügner und entstellten das Wort Gottes, sie seien vertragsbrüchig und verräterisch, sie brächten die Leute um ihr Geld. Im Widerspruch zum Klischee vom judenfreundlichen Islam zieht sich der Antisemitismus von Mohammeds Vernichtung der jüdischen Gemeinde von Medina über die antijüdischen Verfolgungen durch die Almohaden im muslimischen Spanien bis hin zur Praxis der Muslimbruderschaft wie ein roter Faden durch die Geschichte dieser Religion. Die diskriminierende Praxis der dhimma, die Schmidinger wie alle anderen Islamfreunde zu einem regelrechten Glücksfall für die Juden verklärt, ist überhaupt nur denkbar auf der Grundlage der permanenten Drohung mit dem Pogrom, von dem nur bei Unterwürfigkeit abgesehen wird.
Der Antisemitismus findet sich in Koran und Sunna aber nicht nur in Form zahlreicher antijüdischer Stereotype, sondern ergibt sich immanent aus dem islamischen Konzept des Djihad. Davon will Schmidinger noch nie etwas gehört haben. Er stellt sich dumm wie ein deutscher Islamwissenschaftler und behauptet, der Djihad sei eigentlich, also wörtlich übersetzt, eine „Anstrengung, starkes Bemühen“ und könne „ganz unterschiedliche Dinge“ bedeuten. Der innere Djihad sei der „Kampf zwischen Gut und Böse (sic!) im Inneren eines Menschen“, der äußere der „Schutz der islamischen Gemeinschaft, der Umma, und des ,dar al-Islam‘, des Islamischen Landes“.(11) So harmonisch geht es in islamischen Zwangsgemeinschaften aber nur dann zu, wenn der europäische Betrachter „sich anstrengt“ und „stark bemüht“, seine eigene Sehnsucht nach widerspruchsfreier Unterwerfung unter scheinbar natürliche Herrschaftsverhältnisse als Befreiung zu denken. Der Djihad richtet sich seit eh und je gegen Frauen und andere Unreine im Inneren der Gemeinschaft und gegen die vermeintliche jüdische Bedrohung außerhalb der Umma. Nach innen ist der Feind das Verlangen nach sexueller Befriedigung in der Hingabe an den Partner, nach jener heimlich ersehnten Zügellosigkeit, in der man nicht Bezwinger oder Unterworfener sein muß. Der Djihad richtet sich als permanentes Großreinemachen im Haus des Islam gegen den schnöden Materialismus des Geldes und den privaten Sex, gegen das unverdientermaßen gute Leben, das sich gegen die Umma, ihre sturen Rituale im Gebetsrhythmus und ihren Glauben an die gottgegebene Ordnung auflehnen könnte. Je realitätsferner die romantische Sehnsucht nach der islamischen Umma zu Zeiten des frühen Kalifats ist, als angeblich die Welt noch gottesfürchtig und harmonisch war, um so notwendiger wird es, des vermeintlichen Störenfriedes habhaft zu werden und ihn zu vernichten. Je mehr die islamischen Gesellschaften von der zersetzenden Kraft des alle traditionellen Bindungen lösenden Werts durchsetzt werden, um so dringlicher erscheint es auch, diese zersetzende Kraft mit den Juden zu identifizieren. Schmidinger jedoch behauptet steif und fest wider jegliche Realität: „Auf keinen Fall ist der ‚Gihad‘ ein Angriffskrieg gegen nichtmuslimische Bevölkerungen. Er ist immer eine Verteidigung des ‚dar al-Islam‘ gegen das ‚dar al-harb‘, also gegen nichtislamische Staaten.“ (ebd.) Wenn islamische Banden oder Regimes Schmidingers Auffassung vom Djihad nicht teilen und – wie derzeit im Sudan – getreu dem Motto „Angriff ist die beste Verteidigung“ verfahren, so haben auch sie wohl den Islam nicht richtig verstanden. Aber glücklicherweise gibt es ihn ja, den Experten, der nicht nur über den Islam Bescheid weiß, sondern auch über das Christentum, das er als Negativfolie zur Relativierung islamischer Barbarei dringend benötigt.
Crusaders
Religionskritik liegt ihm nämlich auch im Hinblick auf das Christentum nicht. Wo seine Ausführungen über den Koran in bloße Propaganda münden, ereifert er sich über das Christentum ähnlich unkritisch, wenn auch unter umgedrehten Vorzeichen. Jegliche Schandtat des Islam tut er mit dem Verweis ab, auch das christliche Europa habe ja einiges auf dem Kerbholz: „An religiösem Sendungsbewußtsein und manichäischem Denken stehen die ‚Krieger gegen das Böse‘ jenen, die gegen den ‚atheistischen Satan‘ kämpfen, um nichts nach.“ (Context XXI, 6/01)Der angebliche christliche Fundamentalismus Bushs, über dem man an jeder Ecke in Deutschland ein Raunen vernehmen kann, sei die abendländische Entsprechung des islamischen Fundamentalismus, oder auf die ebenso einfache wie hundsdumme Parole gebracht: Fanatismus ist eben immer und überall von Übel. Was tut es da schon zur Sache, daß – anders als der islamische – christlicher Erweckungseifer, der einmal mit Feuer und Schwert antrat, sich die Welt untertan zu machen, seit ein paar hundert Jahren auf dem Rückzug ist und heute kaum mehr als ein lächerliches Randphänomen ist? Die Zeitschrift Context XXI, dessen Redakteur Schmidinger ist, sieht von jeder Empirie unbeeindruckt Ungläubige auf Scheiterhaufen brennen oder der Zwangstaufe unterworfen und betitelte ihre Ausgabe 8/2004 ganz in diesem Sinne in unübertrefflichem Austro-Deutsch folgendermaßen: „Im Starren auf den Islamismus droht das Christentum aus dem kritischen Blick zu geraten.“ Hinter dieser Behauptung steht, wie in dieser Ausgabe u.a. Heribert Schiedel erklärt, der Gedanke, daß die Kritik des Islam dann als rassistisch zu brandmarken wäre, wenn der Kritiker nicht wegen seiner angeblich christlichen Herkunft (ob er gläubiger Christ oder Atheist ist, tut nämlich nichts zur Sache) ständig beteuert, auch das Christentum sei ja ganz schön schlimm. Schiedels Denunziation der vermeintlich rassistischen Islam-Kritik führt ihn zur Verteidigung des Islam: „Die Religionskritik, die da in Anspruch genommen wird, ist keine. Denn zu ihr gehört notwendig die Religionsfreiheit, die eben nicht nur die Freiheit von Religion meint, sondern auch die freie Religionsausübung.“ Klassischer kann die Absage an jeden kritischen Gedanken überhaupt nicht ausfallen. Religion kritisieren dürfe nur, wer auch die religiöse Praxis akzeptiere. Das bedeutet konkret: Ich finde zwar den Islam nicht so gut, weil er Frauen und Mädchen knechtet, aber Kopftuchzwang und Zwangsverheiratung akzeptiere ich als Teil der Religionsfreiheit. Die Religionskritik, die Schiedel vorschwebt, ist also eine folgenlose, ein bloßer Diskurs.
Die Context XXI aber hat sich längst auf den vermeintlichen Fundamentalisten Bush eingeschossen. Andreas Peham schreibt gleich auf Seite 4, „schon die Kreuzzugsmetaphorik der Bush-Administration“ lege nahe, „dass die ideologische Aufrüstung des Westens gegen den ‚islamischen Fundamentalismus‘ sich zusammenfindet mit militanter Re-Christianisierung.“ Worin diese militante Re-Christianisierung konkret bestehen soll, verrät er nicht. Stattdessen bedient er sich des anti-amerikanischen Tricks der „Kreuzzugsmetaphorik“. Daß das englische Wort „crusade“ zwar wortwörtlich mit „Kreuzzug“ zu übersetzen ist, seine Bedeutung aber eine gänzlich andere, nicht unbedingt religiöse ist, verschweigt Peham: In Amerika gibt es crusades beispielsweise gegen Arbeitslosigkeit oder Kriminalität, die nicht mit der Bibel, sondern mit der wirtschaftlichen Situation oder dem Strafgesetzbuch begründet werden. Im Kontext von Context XXI dagegen soll der schillernde Begriff „Kreuzzug“ allen Ernstes Assoziationen an Religionskriege wecken, ganz so, als sei es bei der Befreiung Bagdads oder Kabuls um die Ermordung Ungläubiger und die Unterwerfung Arabiens unter die Herrschaft der anglikanischen Kirche gegangen. Auch Schmidinger hat solche anti-amerikanischen Attacken im Repertoire: „George Bushs Feldzug gegen ‚das Böse‘ ist nicht weniger von religiösem Sendungsbewußtsein geprägt, wie (sic!) die Kreuzzüge des europäischen Mittelalters, die mit den Kreuzfahrerstaaten des Nahen Ostens nicht nur die ersten europäischen Kolonien einbrachten, sondern ‚nebenbei‘ auch noch gleich genutzt wurden, um auf dem Weg nach Jerusalem Jüdinnen und Juden zu erschlagen.“ (Context XXI, 6/01) Es stellt sich bloß noch die Frage, warum die US Marines nicht gleich nach Israel ziehen, um dort die Juden umzubringen. Die Moslems im Irak haben sie ja aus lauter christlichem Fundamentalismus schon fast ausgerottet.
Georg-Weerth-Gesellschaft Köln (Bahamas 47 / 2005)
Anmerkungen:
- www.aktion-november.de/kp.html
- Wie leider so oft bei schlechten Schreibern, ist auch Schmidinger äußerst produktiv. Nicht nur für Context XXI und Jungle World schreibt er, sondern auch für Iz3w, Phase 2, International, Blätter für deutsche und internationale Politik und schließlich – wen wundert’s – für die Zeitschrift Pogrom der Gesellschaft für bedrohte Völker.
- http://home.pages.at/lobotnic/oekoli/content_texte_rechterantiislamismus.html
- http://home.pages.at/lobotnic/oekoli/archiv/rad000328.html
- www.contextxxi.at/html/div/redaktion/schmid inger/palaestlinks.html
- http://home.pages.at/lobotnic/oekoli/archiv/rad000328.html
- http://home.pages.at/lobotnic/oekoli/content_texte_linkeoppositionarabien.html
- http://home.pages.at/lobotnic/oekoli/archiv/r ad000328.html
- Karl Marx: Die Kriegserklärung – Zur Geschichte der orientalischen Frage, in: MEW 10, Berlin 1961, S. 170
- www.contextxxi.at/html/div/redaktion/schmidinger/interviewmitkhalil.html
- www.contextxxi.at/html/div/redaktion/schmidinger/islamfeind.html
SPALTE3-AKTUELL-RUBRIK
Frühere Aktivitäten sind im Aktuell-Archiv aufgeführt. Dort gibt es auch einige Audio-Aufnahmen.
Alle bisher erschienenen Ausgaben der Bahamas finden Sie im Heft-Archiv jeweils mit Inhaltsverzeichnis, Editorial und drei online lesbaren Artikeln.