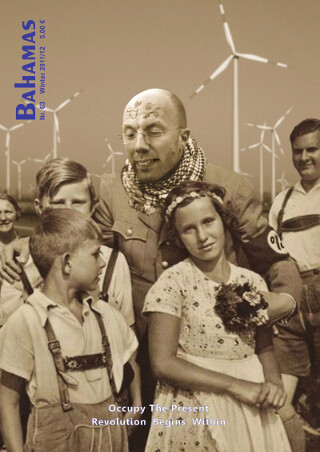Mauerideologien
Von den Beleidigungen guter Erziehung: der 13. August
Einmal kam auch Deutschlands kleinste überregionale Tageszeitung in die Schlagzeilen und zwar mit ihrer eigenen Schlagzeile der Ausgabe vom 13. August 2011. „Wir sagen an dieser Stelle einfach mal Danke“ stand in der Jungen Welt aus Anlass des 50. Jahrestages des Mauerbaus fett zu lesen. Für eine solche Danksagung gibt es durchaus gute Gründe, aber bestimmt nicht diese: „Danke für 28 Jahre Friedenssicherung in Europa […] für 28 Jahre ohne Hartz IV und Erwerbslosigkeit […] 28 Jahre ohne Neonaziplakate ,GAS geben‘ in der deutschen Hauptstadt […] für 28 Jahre munteren Sex ohne ,Feuchtgebiete‘ und Bild-Fachwissen“. Das muss schon ein eigenartiger Frieden gewesen sein, dem zu Liebe Europa und die USA das Grenzregime eines Staates akzeptierten, dessen Bürger in ihrer Mehrheit nur eins wollten: schnell weg. Einen Staat zu loben, der die totale Arbeitspflicht verhängt hat und sogenannte Arbeitsscheue rigoros verknastete, verrät viel über die gar nicht so geheimen Wünsche nicht nur deutscher Kommunisten, sondern eben auch der braunen Konkurrenz. Insofern ist der JW unbedingt beizupflichten, wenn sie der DDR unterstellt, ein antifaschistisches Regime gewesen zu sein. Es war jener staatlich garantierte Zwangsarbeits-Antifaschismus, der zugleich die klemmigsten Männerwitze in Magazinform oder als Kartenspiel verbreitete und zur Verhütung von Feuchtgebieten massenweise staubtrockene FKK-Zonen eingerichtet hatte, der, kaum dass er zusammen mit seinem berühmtesten Bauwerk verschwunden war, als Erbe die größte und mit Abstand militanteste Neonaziszene hinterlassen hatte, die in Deutschland je zu beobachten gewesen ist.
Während man es gar nicht gut findet, NPD-Plakate sehen zu müssen, hofiert man eine Bevölkerung, die für die NPD-Slogans deshalb so empfänglich ist, weil sie sich mit ihren Sprechern darin einig weiß, dass damals nicht alles schlecht gewesen sei. Kaum war die Mauer weg und all die Nazis da, erinnerte man sich voller Sehnsucht an jene „Geborgenheit“ (1), mit der die DDR für ihren Sozialismus geworben und damit nicht wenige Bürger auch überzeugt hatte.
Das Paradox, dass da Leute in einem Staat lebten, den sie zwar rasch verlassen wollten, dessen autoritärem gesellschaftlichen Leitbild sie aber in Liebe anhingen und bis heute vielfach noch anhängen, durfte beim Mauergedenken 2011 einfach nicht vorkommen. Das hatte der JW kurzfristig empörte Schlagzeilen und der Linkspartei Erklärungsnöte eingebracht. Der 13. August hat als nationale Katastrophe zu gelten und nicht als glückliche Verkettung von Umständen, die verhindert hat, dass 1961 oder bald danach zusammengewachsen ist, was damals in weit gefährlicherer Weise zusammengehörte, als es 1989/90 dann doch nur einige besoffene Wochen lang den Anschein hatte. All die westdeutschen Feinde der Jungen Welt zollen dem in der Ostzone vorherrschenden Sonderbewusstsein stets Respekt, kondolieren aber nicht etwa ihren Bewohnern zum Verlust ihres kleinen Preußens, sondern adelten wie Bundespräsident Wulf in seiner Jubiläumsansprache die Wir-sind-ein-Volk-Schreier, denen sich die Staatsgewalt partout nicht in den Weg stellen wollte, zu Freiheitskämpfern in der Tradition des antiken Spartakus: „Noch niemals konnten Menschen auf die Dauer in der Sklaverei gehalten werden“ (FAZ, 15.8.11). Viele Kommentatoren gehen mit einem historischen Zitat hausieren, wonach es sich bei der DDR um ein Konzentrationslager gehandelt habe. Dieses Wort hat nicht etwa Heiner Geissler als CDU-Generalsekretär Anfang der 80er Jahre zum ersten Mal ausgesprochen, wie man heute gern glaubt, nein, es ist von 1961 und stammt von einem legendären Visionär und demokratischen Sozialisten, dem damaligen Regierenden Bürgermeister von Westberlin, Willi Brandt, der doch eigentlich selber mit seinen Frontstadtkameraden hinter Mauer und Stacheldraht saß.
Die CDU-Bundestagsfraktion behauptete in ihrer Erklärung zum Jahrestag, dass das „Gedenken an die Folgen des Mauerbaus notwendiger denn je“ sei und forderte: „Es darf keinen Schlussstrich geben“. Damit war keineswegs gemeint, dass die Folgen des durch die Mauer abgesicherten Regimes, wie sie aktuell in einer Bande von Thüringer Nazi-Mördern zu besichtigen sind, Ansporn sein müssten, jeden Ruf nach vom Staat gestifteter Geborgenheit als volksgemeinschaftlichen Anschlag gegen Minderheiten rechtzeitig zu denunzieren. Wer in Deutschland gegen die sogenannte Schlussstrichmentalität spricht, gibt reflexartig seinem Missfallen über die oktroyierte Staatsraison in beiden deutschen Staaten Ausdruck, der zufolge die deutschen Verbrechen im Nationalsozialismus nicht verjähren und ständige Mahnung zu sein hätten. Die eigentliche, wenn auch informelle Staatsraison, die seit 1945 grollend und um Auf- und Abrechnung bemüht sich gar nicht immer so verdruckst geäußert hat wie 2011, erkennt in „der Mauer“ ein Symbol für ein Leiden der ganzen Nation und der Bürger der DDR im Besonderen. Nie darf darin als Zeichen der eigenen schweren Misshandlung durch die Siegermächte, die Deutschland einfach unter sich aufgeteilt hätten, der Hinweis fehlen, dass das, was man anderen zugefügt hat, man schließlich weit härter noch selber am eigenen Leib hätte erfahren müssen. Pflege des Andenkens an den Mauerbau möchte die DDR keineswegs nur als die „zweite deutsche Diktatur“, die sie zweifellos war, ins Unrecht setzen. Stets tönt es darin vom Schlussstrich, der gezogen werden darf, wenn 200 Tote an der Grenze des „Konzentrationslagers DDR“ mit sechs Millionen ermordeter Juden oder fast zwei Millionen in Gefangenschaft zu Tode gehungerter Sowjetsoldaten aufgerechnet werden.
Das Antibürgerliche
Nicht nur die SED begründete ihren Führungsanspruch mit ihrem Antifaschismus. Die SPD unter der Führung Kurt Schumachers deklarierte die Sozialdemokraten kurzerhand zu den eigentlichen Gegenspielern des NS und leitete aus den Opfern, die die SPD nicht gebracht hatte, ihren politischen Führungsanspruch für die Westzonen ab. Ihrer Analyse, Deutschland sei einem Bündnis von Lumpenproletariat und Lumpenbourgeoisie zum Opfer gefallen, ließ sie die Forderung folgen, den bürgerlichen Kräften dürfe keine Regierungsmacht mehr übertragen werden. Der SED gar nicht unverwandt, organisierte sie Zustimmung über ihr traditionelles Wählerspektrum hinaus, indem sie sich zur Wortführerin derjenigen aufwarf, die die westlichen Sieger davon abhalten wollten, republikanische Verhältnisse in Westdeutschland einzuführen und so der Niederlage einen Prozess der Befreiung folgen zu lassen.
Die 28 Jahre, die die Junge Welt als Idylle aus „Club Cola und FKK“ feiert, stehen für die Einhegung des deutschen Sonderbewußtseins und zwar nicht nur als scheiternde staatliche Alternative zur „Restauration des Kapitalismus“, sondern auch als ein Labor für die nachholende Erziehung im Westen. Dass die schlimmsten antideutschen Befürchtungen über ein Nach-Wende-Deutschland auch nach 20 Jahren nicht eingetreten sind, liegt an der Eingebundenheit der BRD in den Westen, die auch die Angliederung der DDR nicht mehr ändern konnte. Auf die Nachhaltigkeit dieses Zustandes sollte man sich jedoch nicht zu sehr verlassen. Heute wird jedenfalls im Ausland nicht nur im Zusammenhang mit dem Sturz Gaddafis, sondern insbesondere mit der Europapolitik wieder die „Deutsche Frage“ gestellt, die vor allem darin besteht, „wie und zu welchem Zweck Deutschland seine Macht einsetzt – oder auch nicht“ (FAZ, 3.12.11). Die Redaktion der Frankfurter Zeitung für Deutschland positioniert sich neuerdings dort, wo SED und SPD immer schon zu Hause waren – auf Seiten von Geborgenheit und echtem Frieden: „Es ist das wirtschaftlich stärkste Land [in Europa], aber es hat weder den Ehrgeiz noch die Mittel, noch das menschliche Gerüst zur politischen Vorherrschaft in Europa. […] Es will führen, aber ‚herrschen‘ will und kann es nicht. Schon lange nicht mehr.“ In solche bescheidenen, ja demütigen Worte, die in Jahrzehnten erzwungener Vergangenheitsbewältigung erlernt wurden, liegt die Aggression gegen eine Westbindung, die zu überwinden Voraussetzung moralischer Führung ist.
Ulbrichts Mordbuben
Das Mauergedenken diente lange der Legitimation für die gerichtliche Abarbeitung der „DDR-Regierungskriminalität“, der man sich bei der Aufarbeitung der „ersten Diktatur“ so erfolgreich widersetzt hatte. Der Sieg über das „Mauerregime“ wie er in den Bildern über das Berliner Volksfest der Mauerspechte festgehalten ist, die als „Mauerfall“ inzwischen zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören, soll dem Land Glanz verleihen. Dass die größten Löcher in die tausende Kilometer langen Grenzen zum Ostblock von Polen und Ungarn aus geschlagen wurden, geht dabei schnell verloren. Der 13.8.1961 bietet sich nur insoweit als Erinnerungstag an, als er für den späten innerdeutschen Schlussstein der Grenzbefestigungen in Europa steht. Die Grenze zwischen der BRD und der DDR wurde nämlich bereits 1952 geschlossen, als die DDR eine Sperrzone zur Bundesrepublik hin einrichtete und scharf bewachte. Übrig blieb das Vier-Mächte-Berlin inmitten der DDR. Als innerdeutsches Ereignis soll die „Mauer“ der deutschen Geschichte Größe geben, denn durch sie gibt es „neben ihrer dunklen plötzlich eine helle Seite“, die für „Freiheit, Einheit und Frieden“ steht (FAZ, 13.8.11). Am Ende hat Deutschland Europa von der „Diktatur“ befreit, – kein Wort davon, dass erst ein von Deutschland dem Westen aufgezwungener Krieg das Bündnis mit Stalin notwendig machte und die Verantwortung für die Ausweitung des sowjetischen Imperiums eben eine deutsche ist. Es reicht zu wissen: „Die Erinnerung an die Mauer sichert nun, dass das Scheitern dieses Gesellschaftsmodells für immer im Gedächtnis der Welt verankert bleibt.“ (FAZ, 13.8.11)
Heute tut es vielen leid, dass die Mauer so gründlich niedergerissen ist, dass es kaum mehr authentisches Anschauungsmaterial gibt. Man ist schon froh, dass es, neben Mauermuseum und -gedenkstätte, im neuen Dresdener Militärhistorischen Museum, in dem der NS als gleichberechtigter Bestandteil einer Gewaltgeschichte präsentiert wird, als Gruselfaktor ein kleines Mauermodell aus dem Dienstzimmer Erich Honeckers zu betrachten gibt. Darüber hinaus sorgen Spielfilme für Emotion und Fassungslosigkeit, in denen Mauer und Todestreifen ein deutsch-deutsches Liebespaar mit kaltem Beton und stummer Gewalt trennen, um zu überspielen, dass vom „Glück“ der Vereinigung nach wenigen Wochen nur Ossis und Wessis geblieben sind, die sich genervt bis feindlich gegenüberstanden und sich häufig nur in ihrer Friedensliebe und der Aufregung über ein gemeinsames Ausländerproblem einig waren.
Die Übereinstimmung zwischen Ost und West, wie dem Mauerbau zu gedenken sei, geht viel weiter, als die gelegentlichen lautstarken Streitigkeiten vermuten lassen. Inzwischen folgt das jährliche Gedenken einem vom ehemaligen Berliner SPD/PDS-Senat ausgearbeiteten Konzept, das besonders den Mauertoten einen festen Platz sichert, deren bekanntester Peter Fechter geworden ist. Die Geschichte vom qualvollen Tod des 18-jährigen Ostberliner Maurers, der am 17. August 1962 in den Sperranlagen an seinen Schusswunden verblutete, weil ihm keiner der verantwortlichen DDR-Grenzer zur Hilfe gekommen sei, wird zum 13. August hundertfach erzählt. Unerwähnt bleibt in dieser exemplarischen Erzählung der Anteil, den die Westberliner Seite an seinem Tod trägt. Eine Schuld, die schon damals auf andere geschoben wurde und schließlich zur ersten antiamerikanischen Demonstration in Westberlin führte.
Der Spiegelberichtete in seiner Ausgabe 35/1962, dass Fechter die Sperranlagen mittags 100 Meter vom Checkpoint Charlie entfernt übersteigen wollte. Während ein zweiter Flüchtling Glück hatte, brach Fechter in den Sperranlagen vor der Mauer dreifach getroffen zusammen. Innerhalb weniger Minuten strömten Hunderte von Westberlinern in die unmittelbare Nähe des Ortes, wo Fechter lag. „In Sprechchören taten sie den Volkspolizisten kund, man werde mit ihnen, den Ulbricht-Mördern, abrechnen.“ Auch versammelte sich „auf westlicher Seite schließlich eine ansehnliche Polizeistreitmacht“ und richtete „ihre Schnellfeuerwaffen drohend gen Osten“, sodass „sich die Volkspolizisten in ihre Schießstände zurückzogen“. „Zwischen den Fronten lag Peter Fechter. Eine dreiviertel Stunde lang schrie er um Hilfe. Niemand half.“ „Eingeschüchtert durch Schnellfeuergewehre und drohende Sprechchöre, warteten die östlichen Grenzbrigadiers auf Verstärkung. Sie hatten Angst. Wochen zuvor hatte eine westliche Kugel einen ihrer Genossen, den Grenzpolizeigefreiten Huhn, wenige Meter vom Schauplatz des neuen Zwischenfalls entfernt, getötet.“ Da ein anwesender US-Offizier sich an seine Order hielt, die ihm untersagte, DDR-Flüchtlinge bei der Flucht über die Mauer zu unterstützen, waren am Folgetag die Fronten verkehrt: „Amerikanische Soldaten, bislang als Freunde und Beschützer geachtet, wurden mit Buh-Rufen und der kommunistischen Parole ‚Ami, go home‘ bedacht“, auf der abendlichen Demonstration an der Mauer wurde ein Transparent mit der Aufschrift „Schutzmacht? Morddulder = Mordhelfer“ gezeigt und die „Westberliner Polizei musste die Ulbricht-Mauer und deren sowjetzonalen Wächter vor anrückenden Demonstranten schützen.“ Daraufhin stationierten die Amerikaner einen Sanitätswagen am Checkpoint Charlie. „Dieses Vehikel alliierter Barmherzigkeit“ hatte eine klare Order: „Ein geborgener, angeschossener Flüchtling ist unverzüglich in das nächstgelegene Ostberliner Krankenhaus einzuliefern.“ Die Westberliner Polizei hatte Fechter gegen seine Bergung durch DDR-Grenzer beschützt, anstatt zu seiner Rettung beizutragen, obwohl sie bereits ein Jahr Zeit hatte, sich auf solche Fälle vorzubereiten, Wessis und Ossis waren damals ohne ihre Siegermächte unfähig zu konstruktivem Verhalten.
Der offensive Frontstaat
Gleich nach der Abriegelung Berlins, ein Jahr vor dem Tod Fechters, wollte Bürgermeister Brandt die vor dem eigentlichen Mauerbau installierten Absperrungen an der Westberliner Grenze von den Amerikanern abgeräumt sehen. In Erinnerung an die eigene Standhaftigkeit bei der Berlinblockade gab es die Erwartung, dass die Amerikaner sich von den Russen nichts gefallen lassen würden. Man glaubte, Amerikaner und Deutsche hätten die gleichen Probleme und hoffte durch die exponierte Lage Westberlins, die militärische Macht der Westalliierten für die eigene nationale Politik instrumentalisieren zu können. Dabei hatte Präsident Kennedy seine Haltung zur Absperrung Berlins bereits am 25. Juli 1961 in einer Ansprache deutlich gemacht: „Heute verläuft die gefährdete Grenze der Freiheit quer durch das geteilte Berlin. Wir wollen, dass sie eine Friedensgrenze bleibt“ (2), und der Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses des US-Senates, William Fulbright, hatte am 30. Juli im Fernsehen erklärt, wenn die DDR morgen ihre Grenzen schließen würde, um den Flüchtlingen den Weg zu verbauen, dann könne sie das tun, ohne irgendeinen Vertrag zu verletzen. Er verstehe nicht, warum sie ihre Grenzen nicht dicht machte. (3) Nachdem die deutschen Staaten in die jeweiligen Militärbündnisse integriert waren, wollten die USA und die SU Ruhe an der „gefährdeten Grenze“ und Deutschland sollte nicht mehr die Agenda der Sicherheitspolitik bestimmen können. So folgte – auch als Ergebnis auf die Kubakrise vom Oktober 1962 – eine Politik der Berechenbarkeit. Es gab erste Schritte auf dem Weg zu einer umfassenden Rüstungskontrollpolitik, die 1968 zum Abschluss des Nichtverbreitungsvertrages für Kernwaffen führte und anschließend zu Verhandlungen über die Begrenzung der strategischen Rüstungen (SALT) zwischen den USA und der Sowjetunion.
Bundeskanzler Adenauer enthielt sich jeder Forderung an die Westalliierten, gewaltsam vorzugehen. Seine Politik der Westintegration war durch die Mauer nicht gefährdet, eher fürchtete er eine Verständigung zwischen USA und SU über deutsche Belange, bei der die USA Zugeständnisse machen könnten. Solchen Entwicklungen vorzubeugen, war Adenauers „Politik der Stärke“ und Unversöhnlichkeit gegen DDR und SU verpflichtet, die mit antikommunistischer Spannung nach innen und außen der Stabilisierung des Westens dienen sollte, denn eine Politik der Entspannung drohte den Status Quo zu zementieren. Mit der Mauer war der Destabilisierung der DDR jedoch eine klare Grenze gezogen, ebenso wie die nationalistische Politik der SU und deren Versuche, Berlin der DDR einzuverleiben, inzwischen der Vergangenheit angehörten. Die Mauer führte den Westdeutschen vor Augen, dass sich die Hoffnung, man könne eine nationale Rehabilitation mit der eigenen Unentbehrlichkeit als Frontstaat an der Systemgrenze erreichen, als Luftbuchung erwiesen hatte. Es wurde vielmehr deutlich, dass die BRD langfristig eine konstruktive politische Rolle einzunehmen hatte. Statt die deutsche Frage durchzusetzen, fand man sich als eines unter vielen Mitgliedern im westlichen Bündnis wieder und Brandt schrieb später, durch den Mauerbau und die verhaltenen Reaktionen des Westens, speziell der USA, seien ihnen Illusionen, „die sich an etwas klammerten, das in Wahrheit nicht mehr existierte“ (4), genommen worden. Die DDR hatte dies durchaus beabsichtigt, wie 1964 staatsoffiziell resümiert wurde: Sie habe „dem Frieden in Europa einen großen Dienst erwiesen, indem sie den regierenden Kreisen in Westdeutschland unmissverständlich ihre Grenzen wies. Diesen wurde der Stand des Kräfteverhältnisses in Deutschland klargemacht. Die bislang ungeregelten Verhältnisse an der Grenze der DDR zu Westberlin hatten nicht nur umfangreiche Machenschaften zur Schädigung der DDR zur Folge, sondern nährten auch gewisse Illusionen innerhalb der herrschenden Kreise Westdeutschlands hinsichtlich der Beseitigung der gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR.“ (5) Das Bestreben der SU und der USA, den jeweils anderen nicht den beherrschenden Einfluss auf das gesamte Deutschland erlangen zu lassen, und der Umstand, dass es nicht nur um eine deutsche Grenze ging, veranlasste bereits unter Adenauer den Frontstaat BRD, eine konstruktivere Rolle als zuvor zu finden.
Die schwache DDR
Die von allen vier ehemaligen Alliierten trotz gegenteiliger Beteuerung damals nicht gewünschte deutsche Einheit wäre ohne den Bau der Mauer durch den Zusammenbruch der DDR dennoch eingetreten. Die Führung der DDR forderte Moskau auf, der Abriegelung gegen den erfolgreichen Westen zuzustimmen, denn die scheinbar unbegrenzte Aufnahmefähigkeit des westdeutschen Arbeitsmarktes, die Aufstiegsmöglichkeiten und das hohe Einkommen bei relativ kurzen Arbeitszeiten und beispiellosen Sozialleistungen, bildeten einen allzu großen Kontrast zu den Verhältnissen im Oststaat. Der Verlust von Arbeitskräften an den Westen hielt schon lange und unvermindert an. Über vier Millionen Abgänge hatte es schon gegeben und gerade die leistungsfähigen Altersgruppen wechselten in den Westen, der nicht nur diese Arbeitskräfte integrierte, sondern zusätzlich seit 1955 mit diversen Ländern Abkommen über den Zuzug von weiteren schloss. Das größte Problem der DDR war der eklatante Mangel an Facharbeitern und Spezialisten wie z.B. Ärzten. Jeder Schritt hin zu dem, was man für den Sozialismus hielt, sorgte für das weitere Anschwellen der Aussiedlungswellen, wie noch 1960 die forcierte Kollektivierung auf dem Land unter den Bauern. Die BRD hingegen brauchte sich aufgrund des beständigen Zustroms von ausgebildeten Arbeitskräften nicht einmal um ein angemessenes Bildungssystem zu sorgen, was erst ab 1965 institutionell korrigiert wurde.
Zwar vermochten die etwa 500.000 sowjetischen Soldaten die Bevölkerung von einem neuen Aufstand wie 1953 abzuhalten, doch die Abwanderung ließ sich nicht eindämmen. Das passte nicht zu den Erwartungen, die auf der DDR lasteten, wie sie der Erste Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrats in Moskau, Anastas Mikojan, der SED-Führung im Juni 1961 übermittelte: „Die DDR ist der westliche Vorposten des sozialistischen Lagers. Deshalb schauen viele, sehr viele, auf die DDR. In der DDR wird sich unsere Weltanschauung, unsere marxistisch-leninistische Theorie beweisen müssen […] Gegenüber Westdeutschland können und dürfen wir uns einen Bankrott nicht leisten. Wenn der Sozialismus in der DDR nicht siegt, wenn der Kommunismus sich nicht als überlegen und lebensfähig erweist, dann haben wir nicht gesiegt. So grundsätzlich steht für uns die Frage.“ (6) Die Sowjets beabsichtigten deshalb die Handlungsmöglichkeiten der DDR zu erweitern und ihren Status durch einen einseitigen Friedensvertrag aufzuwerten, wodurch jedoch die Besatzungsrechte der Alliierten, insbesondere der ungehinderte Zugang nach Westberlin, behindert worden wäre, was die USA als Herausforderung und vielleicht auch Kriegsgrund angesehen hätten. Die SU ging einer Eskalation in dieser Frage aus dem Weg und die DDR bekam statt eines Friedensvertrags mit der Mauer den Status eines einigermaßen stabilen Staates.
Dem Bau der Mauer ging das Scheitern der Versuche der SU voraus, im Bündnis mit den sogenannten revisionistischen Kräften eine Massenstimmung für die Vereinigung und gegen die Attraktivität des westlichen Kapitalismus und die Weltmarktintegration zu mobilisieren und zu dominieren. Adenauers Kurs und der wirtschaftliche Erfolg im Westen ließen an diesem Scheitern keinen Zweifel zu. Was die SED 1947 als Volkskongressbewegung für deutsche Einheit und einen gerechten Frieden mit einem Kongress am 6. Und 7. Dezember anschob, an dem 2.200 Personen teilnahmen, davon 600 aus den Westsektoren, wenn auch hauptsächlich KPD-Anhänger (7), fand über die KPD hinaus viel Zuspruch. Es führte Linke und Rechte in eine Bewegung, deren Motto Wiedervereinigung statt Westintegration lautete. In einer Front standen Anhänger eines neutralen Deutschlands mit Streitern für eine Befreiung von den Supermächten und den Pazifisten. Dazu kamen jene, die von einer Dritten Kraft Europa schwärmten und natürlich die vielen „3-geteilt? Niemals!“-Bewegten. Der verbreitete Wunsch, volksgemeinschaftliche Werte gegen „individualistische Verflachung“ zu verteidigen, wurde ebenfalls angesprochen. Kurt Schumacher wollte diese Themen natürlich nicht kampflos der DDR überlassen und gab zu verstehen, dass es weder möglich sei „den Deutschen die Demokratie westlicher Prägung aufzupfropfen, noch daran zu denken, das ‚bankerotte [sic] Preußentum mit Hammer und Sichel wieder erstehen zu lassen‘.“ (8)
Das nationale Programm
Die pazifistische Haltung, die sich mit einem moralischen Überlegenheitsgestus verband, war in der SPD zunächst in der Mehrheit. Militärischer Schutz wurde als die Aufgabe der Alliierten angesehen, während man die Stärken der Deutschen in politischen, sozialen und ideologischen Fragen sah. Sollte dazu auch noch wirtschaftlicher Erfolg kommen, sah man Deutschland schon als Vorbild erstrahlen, das die Völker im Osten magnetisch anzuziehen in der Lage wäre. Der Erfolg begann schließlich mit der Nutznießerrolle im Koreakrieg (1950 bis 1953), zu dem die deutsche Wirtschaft als einzige eines westlichen Industriestaates erhebliche Kapazitätsreserven mobilisieren konnte. Bis 1952 galt die „Durchbruchskrise“ der Sozialen Marktwirtschaft als bewältigt und Ende 1954 lag die westdeutsche Industrieproduktion fast doppelt so hoch wie 1936. (9) Dies brachte die späte Einlösung der Versprechen, die Hitler nicht erfüllt hatte, zeitigte aber andere Folgen als Schumacher und viele in seiner Partei erwartet hatten. Denn wie schon zur Berlinblockade, liefen viele Anhänger eines Dritten Weges zum Westintegrationskurs über. Man flüchtete sich geradezu in die Arme der westlichen Mächte, denn in Korea hatten die durch die SU ausgerüsteten Truppen des Nordens den Süden überfallen, um die Wiedervereinigung des ebenfalls 1945 unter sowjetischem und amerikanischem Einfluss geteilten Landes zu erzwingen. Die SU wurde immer stärker als Gefahr angesehen und viele ereiferten sich in wahnhaft-großsprecherischer Weise, dass an der bundesdeutschen Grenze das Abendland gegen Asien verteidigt werde.
Schumacher griff diese Stimmungen auf und forderte gegen eine defensive Wiederaufrüstung die massive Stationierung westalliierter Truppen in Deutschland, um einen sowjetischen Angriff offensiv im Sinne einer Vorneverteidigung parieren zu können. Eine Kriegsentscheidung sei an Memel (also fast der Grenze Ostpreußens nach Norden) und Weichsel (also jenseits von Pommern und Schlesien wieder auf auch 1937 polnischem Gebiet) zu suchen, was dem Anspruch der SPD auf die Grenzen von 1937 entsprach. Seine Partei erhob die Forderung nach einer „unlösbaren Kopplung des angelsächsischen militärischen und politischen Schicksals mit dem unseren“ (10). So verkehrte sich das Ziel der Alliierten, Sicherheit vor Deutschland zu bekommen, ins Gegenteil. Erst als man erfahren musste, dass deutsche Kontingente unter dem Oberbefehl der Alliierten Westeuropa an der Elbe zu verteidigen hätten, schwenkte die SPD Ende 1951 wieder auf den Kurs des nationalen Pazifismus ein. Die Unterzeichnung des Generalvertrages mit den drei Westmächten 1952 (in Kraft trat er 1955), der für die BRD die weitgehende Souveränität bedeuten sollte, quittierte Schumacher auf Adenauer gemünzt mit dem Satz: „Wer diesem Generalvertrag zustimmt, hört auf, ein Deutscher zu sein“ (11) und rief zusammen mit vielen anderen quer durch die Parteien dazu auf, die sowjetischen Noten mit Vorschlägen zu einem Friedensvertrag, der eine Westintegration ausgeschlossen hätte, zu unterstützen. Schumacher befand sich damit auf einer Linie mit dem Politbüro der SED, das die sowjetischen Noten gegen den „Generalkriegsvertrag“ stellte. (12)
Die Ost-West-Konfrontation führte also zur Stärkung des Nationalpazifismus, der sich der Agitation gegen einen Krieg auf deutschem Boden verschrieben hatte. Ein antirussischer Westblock widerspräche nach Schumacher einer Politik des Ausgleichs und eine gewaltsame Politik liefe auf die gewaltsame Lösung von Konflikten zwischen den Siegermächten hinaus, was mit der Ausradierung Deutschlands von der Landkarte enden würde. Während Schumacher eine Offensivstrategie gegenüber den Westmächten verfolgte, handelte Adenauer defensiv. Der Antipreuße verlegte sich darauf, die Sicherheitsbedürfnisse der Sieger ernst zu nehmen, um so die Souveränität für den Weststaat zu erlangen.
Immer wieder gewann Adenauer für seine Schritte zur Westintegration die Zustimmung nationalistischer Ultras, die mit seinem ganzen Kurs nicht unbedingt einverstanden waren, während Schumacher sich in nationalen Dingen als der eigentliche Anführer präsentierte. Wegen Adenauers Zustimmung zu einer deutschen Beteiligung an der im März 1949 von den Westalliierten gebildeten Internationalen Ruhrbehörde, der Vorgängerin der Montanunion und damit die indirekte Anerkennung der Kontrolle über die deutsche Stahlindustrie und Kohleförderung, machte Schumacher aus ihm den „Kanzler der Alliierten“ und griff ihn als „Erfüllungspolitiker“ an – eine Bezeichnung, die untrennbar mit dem Mord an Matthias Erzberger im Jahre 1921 verbunden ist. Adenauer verlor durch den Mauerbau nicht so viele „Illusionen“ wie die SPD. So hatte er dem damaligen SPD-Chef Erich Ollenhauer 1955 erklärt: „Oder-Neiße, die Ostgebiete – die sind weg! Die gib es nicht mehr!“ (13). Am Ende seines Lebens verabschiedete er sich sogar von seiner Ostpolitik der Stärke, als er in seiner Abschiedsrede an die CDU 1966 die Überzeugung aussprach: „Sowjetrussland ist in die Reihe der Völker eingetreten, die den Frieden wollen“. (14)
Befreiung von der Befreiung
In Westdeutschland war man zugleich mit dem Kampf gegen die Alliierten beschäftigt, statt sich gegen ein Wiedererstarken des NS einzusetzen oder sich um die Befreiung der Köpfe und Herzen zu kümmern. Am 15. Januar 1953 schlugen die Engländer zu und verhafteten unter Verweis auf das Besatzungsstatut sechs zum Teil ranghohe frühere Mitglieder der NSDAP, die Pläne zur „Wiederergreifung der Macht in Westdeutschland“ mithilfe der FDP schmiedeten. Die Nazis strebten ein wiedervereinigtes Deutschland an, das im Spannungsfeld zwischen Ost und West die Situation zu Zugeständnissen von beiden Seiten ausnützen könnte und hofften, Neutralisten und Anhänger des Dritten Weges sammeln zu können. Eine britische Studie sah das „Konzept der europäischen Einheit und westlichen Verteidigung“ in Gefahr. Von der FDP wurde das Vorgehen der Engländer verurteilt und die beweisbaren Tatsachen einfach geleugnet. Adenauer begrüßte das britische Vorgehen, war aber froh, dass nicht er, sondern die Besatzer das heikle Thema anpackten. Deutsche Stellen waren nicht willens, eine solche Aktion abzusegnen, und so bestand der deutsche Beitrag neben der Kritik an der Eigenmächtigkeit der Briten darin, dass der Bundesgerichtshof im August den Hauptbeschuldigten, den ehemaligen NS-Staatssekretär Werner Naumann, auf freien Fuß setzte. (15)
Vehement und pauschal setzten sich Politik und Öffentlichkeit auch für die von den Alliierten verurteilten Kriegsverbrecher ein. Souveränität zu erlangen wurde als „vergangenheitspolitische Selbstbestimmung“ (16) interpretiert und so machte man sich, soweit die Alliierten nicht dazwischen gingen, die Integration aller NS-Beschuldigten und Verurteilten zur Aufgabe. Mit der Rehabilitierung der Gefangenen ging die Rehabilitierung der Vergangenheit einher. Der „Wehrbeitrag“ wurde mit der Forderung nach der Freilassung der verurteilten Kameraden und der Wiederherstellung der Ehre der deutschen Soldaten verbunden. Die Sühnemaßnahmen wurden nur noch aufgrund alliierten Drucks ertragen und die Verfolgung von NS-Straftaten als Siegerjustiz delegitimiert. Das Wort von der „Befreiung von der Befreiung“ machte die Runde. Kurz nach Gründung der BRD gönnte man sich erst einmal Amnestiegesetze, zu denen der Zentrumspolitiker Bernhard Reismann im Bundestag ausführte, „dass der Grundgedanke der Notwendigkeit, Vergessen über die Vergangenheit zu decken […] von allen Parteien des Hauses anerkannt wird.“ (17) Opposition, Regierung und Bundespräsident setzten sich für die in alliierter Haft sitzenden Volksgenossen ein. Je weniger NS-Verbrecher im Gefängnis saßen, desto unbezähmbarer wurde das Verlangen, die Sache selbst zu tilgen. Der politischen Statusverbesserung durch die zunehmende Integration in den Westen stand deswegen ein internationaler Verlust an moralischer Glaubwürdigkeit gegenüber.
Die Amerikaner, die mit den Dachauer und Nürnberger Prozessen die Führungsrolle bei der Verurteilung von Teilen der politischen, militärischen, bürokratischen und wirtschaftlichen NS-Elite übernommen hatten, standen ganz besonders in der Kritik. Der Stuttgarter Landesbischof Theophil Wurm forderte in einem Brief an John Foster Dulles, die Amerikaner sollten „den Hitlergeist auch bei sich selber austreiben“ (18). An den zwar verurteilten aber noch nicht hingerichteten Kriegsverbrechern entdeckten die Deutschen ihre Abscheu vor der Todesstrafe, die nach dem Vorschlag eines Vertreters der Deutschen Partei, die in drei Adenauerkabinetten vertreten war, 1949 im Grundgesetz für abgeschafft erklärt wurde.
Am 7. Januar 1951 fand am Ort des War Criminals Prison No. 1 der US-Army in Landsberg unter großer öffentlicher Zustimmung eine Demonstration von mehr als 3.000 Personen, darunter natürlich auch Sozialdemokraten, für die Begnadigung dort einsitzender Todeskandidaten statt. Den Kundgebungsplatz suchten auch ca. 300 Gegendemonstranten auf, die aus dem ebenfalls in Landsberg von der US-Army eingerichteten und von den Einheimischen abgelehnten Lager für Displaced Persons kamen. Sie gedachten der 90.000 jüdischen Opfer, die auf Befehl des in Landsberg einsitzenden Otto Ohlendorf ermordet wurden. Davon fühlten sich die Feinde der Todesstrafe so provoziert, dass sie handgreiflich wurden und ihre Gegner mit Juden-raus-Rufen aus hunderten von Kehlen eindeckten. Die Polizei nahm einige der DPs fest und der Oberbürgermeister der Stadt erklärte in seiner Rede, die „Zeit des Schweigens“ sei vorbei, die protestierenden Juden sollten dorthin zurückkehren von wo sie gekommen seien. (19) Der zähe Kampf um die Freilassung der „Kriegsverurteilten“ stützte sich auf die großen Parteien, die die Bewegung ebenso anführen wollten wie rechtsradikale Agitatoren. Im Ausland wurde zugleich die Gefahr eines Rückfalls Deutschlands in den NS als Dauerproblem wahrgenommen.
Adenauer drängte die Alliierten, größere Zugeständnisse in der NS-Verbrecherfrage zu machen, um auf diese Weise seine Wiederwahl zu fördern und verwendete sich für die Befreiungsbewegung, die in seinen Regierungen nicht nur der FDP ein besonderes Anliegen war, sondern auch der Deutschen Partei, aus deren Reihen später die NPD mitgegründet wurde. Deren Vorsitzender, der Grundgesetzgegner (weil es aufgezwungen sei) und Verkehrsminister Christoph Seebohm, fungierte auch als Vorstandsmitglied der Sudetendeutschen Landsmannschaft und trat mit einem polternden Revisionismus auf, der zu offiziellen Beschwerden des Hohen Kommissars bei Adenauer führte. Die Partei Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten, die als Entrechtete die Opfer der Entnazifizierung ansah, später den Namensvorsatz Gesamtdeutscher Block trug und von September 1953 bis Oktober 1955 in der Regierung vertreten war, verfügte über einen SS-Sturmbannführer als Vorsitzenden (Waldemar Kraft) bis ihn der Vertriebenenminister, Hitlerputschist und Ostlanderoberer Theodor Oberländer (schließlich CDU) ablöste. Oberländer machte ein DDR-Gericht am 29. April 1960 in Abwesenheit einen Schauprozess und verurteilte ihn ohne eindeutige Beweise wegen der Beteiligung an der Erschießung von mehreren tausend Juden und Polen in Lemberg zu lebenslänglichem Zuchthaus. Adenauer wollte Oberländer selbst danach zunächst noch als Minister halten. Erst später erkannte man in der BRD, dass es die Frage der nationalen Souveränität direkt berührte, ob der NS nur von anderen oder auch im Land „aufgearbeitet“ wird. Doch bis es dazu kam bedurfte es noch vieler peinlicher Interventionen aus der DDR, des Falles Eichmann in Jerusalem, der Filme Shoah und Holocaust usw.
Der Blick vom nahen Westen
Nicht nur die Alliierten, sondern auch die kleineren Nachbarn hatten ihre Probleme beim Umgang mit diesem Deutschland. In den Niederlanden wurde nach dem Krieg die Frage diskutiert, ob der Schutz vor Deutschland oder, trotz aller Vorbehalte vonWest-Deutschland, vor der Sowjetunion Priorität bekommen müsste. Als größte Gefahr galt dort ein wiedervereinigtes Deutschland im Bündnis mit der SU. Für beide Fragen fand man eineAntwort: am besten sei die Integration der BRD in die westliche Zusammenarbeit (20). Den Haag befürwortete eine gleichberechtigte Integration und eine Bewaffnung der BRD im atlantischen (nicht im europäischen) Verband, woraus sich die Unterstützung Adenauers ergab, des aus holländischer Sicht „wertvollsten“ Deutschen (21). Diese Linie wurde beibehalten, obwohl die Deutschen bei den Niederländern nicht beliebt waren. Widerstand gegen die deutsche Bewaffnung gab es von Kommunisten, Friedensgruppen, Dritte-Weg-Anhängern und Kirchen. Entscheidend war aus Sicht der niederländischen Politik, dass die deutschen Ambitionen auf eine eigenständige Außenpolitik ausgeschlossen bleiben sollten, zumal die nicht-eigenständige für den kleinen Nachbarn bereits viele Zumutungen bereithielt.
Im August 1950 setzte sich das Bundeskanzleramt ohne Erfolg für den zuvor zum Tode verurteilten SD-Chef in Amsterdam und Leiter der Zentralstelle für jüdische Auswanderung, Willy Lages, ein, der Zwangsaussiedlungen ebenso wie die Deportationen in die Vernichtungslager zu verantworten hatte. Bonn behauptete wahrheitswidrig, dass Lages sich „trotz der damit für ihn verbundenen persönlichen Gefährdung nach Kräften und bereitwillig alles getan hat, um Exzesse zu verhindern und politisch Verfolgten zu helfen“ (22). Das Thema blieb auf der Agenda und als 1955 der niederländische Justizminister erklärte, es werde keine vorzeitigen Entlassungen deutscher Kriegsverbrecher geben, brandeten deutsche Proteste auf, und deutsche Firmen drohten ihren Handelspartnern mit Boykott. (23) Die Reserviertheit der Holländer in dieser Frage hatte sich noch verfestigt, seit dem im Dezember 1952 sieben zu lebenslanger Haft verurteilte Naziverbrecher aus dem Gefängnis Breda ausbrachen und mit bereitstehenden Autos in die Bundesrepublik gebracht worden waren. Sechs von ihnen war ihre niederländische Staatsbürgerschaft wegen Kollaboration entzogen worden. In Deutschland angekommen, nahm man sie fest, verurteilte sie wegen illegalen Grenzübertrittes zu 10 Mark Strafe und ließ sie am Folgetag frei. Das sich anschließende diplomatische Tauziehen brachte einen der sieben wieder ins niederländische Gefängnis, die anderen sechs versorgten bundesdeutsche Oberlandesgerichte in zuverlässiger Weise: da eine deutsche Staatsbürgerschaft zumindest nicht ausgeschlossen werden konnte, kam eine „Auslieferung“ nicht in Frage. (24) Die letzten in den Niederlanden einsitzenden NS-Täter kamen, nicht zuletzt wegen dieser Affäre, erst im Januar 1989 aus dem Gefängnis.
Den Westen im Rücken
Wenn heute die verschwundene Mauer als ein Symbol für den Sieg von Frieden und Freiheit ausgegeben wird, so kann dies doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass mit der Mauer nicht die mit ihr verbundenen Themen verschwunden sind. Frieden und Atom können in Deutschland Massen mobilisieren, was auch mit Traditionslinien aus der frühen Bundesrepublik wie den Neutralitätsbestrebungen und der Überzeugung, ein Opfer der Ost-West-Konfrontation geworden zu sein, zusammenhängt. Pazifistische und nationalistische Haltungen sind dabei nicht zu trennen. Alfred Mechtersheimer, der von rechts außen zu den Grünen gestoßen war, ohne sich je zu verleugnen, hat das 1978 offen bekannt: „Für mich war immer klar, seit ich mich mit Abrüstung beschäftige: eigentlich geht es gar nicht um eine Raketendiskussion, sondern um die deutsche Frage. Das ist der Kern der Debatte, es hat gar keinen Sinn, drumherum zu reden.“ (25)
Die amerikanisch geprägte Entspannungspolitik definierte Willy Brandts Berater Egon Bahr in den 60er Jahren in eine deutsche „Strategie des Friedens“ um: „Zunehmende Spannung stärkt Ulbricht und vertieft die Spaltung“. Manch einer möge die Sorge haben, dass dadurch die Unzufriedenheit in der DDR nachlassen könnte, „aber eben das ist erwünscht“, denn sonst könnte es zu „unkontrollierbaren Entwicklungen“ kommen wie zum Aufstand am 17. Juni 1953 oder zur Flut von Emigranten 1960–61, die zu „zwangsläufigen Rückschlägen“ führen müssten. „Die Frage ist, ob es nicht Möglichkeiten gibt, diese durchaus berechtigten Sorgen [um die Selbsterhaltung] dem Regime graduell so weit zu nehmen, dass auch die Auflockerung der Grenzen und der Mauer praktikabel wird“. (26) Bahr hatte zwei Konzepte seiner „Normalisierungspolitik“ ausgearbeitet, eines, das die Verankerung im Westen voraussetzte und umgesetzt wurde und ein zweites, das längerfristig angelegt war und sich dem ersten anschließen sollte. Darin wurde als „deutsche Interessenlage“ herausgearbeitet, dass „die Überwindung der Teilung Deutschlands“ ein vollständig neues Sicherheitssystem erfordere, das die Nato und den Warschauer Pakt ersetzen sollte. Das Hauptquartier dieses Systems sollte in Berlin angesiedelt sein und würde aus einer zentralen Zone atomwaffenfreier Staaten bestehen, den beiden deutschen, den Beneluxländern, Polen und der Tschechoslowakei. In diesen Ländern sollte es keine fremden Truppen geben und die kollektive Sicherheit wäre von den atomaren Supermächten zu garantieren (27). Brandt und Bahrs Engagement für eine Truppenreduzierung in Europa war offensichtlich dieser langfristigen Strategie verpflichtet.
Adenauers Politik orientierte sich an einer Synchronisation des westlichen Vorgehens: Wollte die BRD ihre Kontakte nach Osteuropa ausdehnen, musste das gesamte Westeuropa seine Kontakte in den Osten verstärken. Brandt und Bahr verfolgten dagegen einen bismarckschen Multilateralismus, der die Möglichkeiten der BRD, selbständige Politik zu betreiben mit der Annäherung SU verband. Bundeskanzler Schmidt zog schließlich die Konsequenz und machte die Stabilität zum Dreh-und Angelpunkt seiner Politik. (28) Mit der Gründung der polnischen Solidarnosc im August 1980 bedrohte diese die deutsche Ostpolitik der Stabilität, was nach der Verhängung des Kriegsrechtes in Polen 1982 zu einem immer wieder neu aufflammenden Streit mit den USA über Sanktionen gegen Moskau und Warschau führte. Die USA verhängten Sanktionen, weil Reagan die SU für die Ausrufung des Kriegsrechts in Polen verantwortlich machte, während Schmidt darin eine innere Angelegenheit Polens erkannte. Die Strategen des Weltfriedens betrachteten eben alles von deutscher Warte aus: „Die Polen mussten ihren Freiheitsanspruch im Zaume halten, damit die Deutschen ihren Anspruch auf Einheit weiterhin aufrechterhalten konnten“, urteilte Timothy Garton Ash. (29)
Die Ostpolitik der SPD setzte auch Bundeskanzler Kohl fort, der zusammen mit Honecker die gemeinsame „Verantwortung“ für die Politik der Zusammenarbeit betonte und für stabilisierende Kredite sorgte. In der Betonung einer gemeinsamen Verantwortung der beiden deutschen Staaten für den Frieden spiegelte sich immer mehr die offizielle DDR-Linie (30), einer Regierung also, die im östlichen Bündnis eine Hardliner-Rolle spielte. Für Stabilität sorgte auch die Bedeutungslosigkeit der Opposition in der DDR, die sich keine bürgerlichen Tugenden aneignete und keine reformtauglichen Kräfte hervorbrachte, im Gegensatz zu den Oppositionellen anderer osteuropäischer Länder. Die Abwesenheit von Selbstachtung und die Demoralisierung der Ostdeutschen nach 1989 entsprach diesem Vorlauf. Stabilität ist das Schlüsselwort der deutschen Nachkriegsgeschichte und auch die Mauer stand für Stabilität. Die Freiheit, die man im Zusammenhang mit dem Fall der Mauer für sich reklamiert, hat sich Deutschland immer nur aufzwingen lassen. Sie ist der Verdienst anderer, 1945 und auch danach. Man kann sich für 28 Jahre Mauer am wenigsten bei den Oberen der DDR oder der SU bedanken. Dass die Deutschen sie eben auch nach dem Willen der Westalliierten haben hinnehmen müssen und in dieser Zeit gezwungen waren, sich nicht nur zu benehmen, sondern auch strukturell ihr Gemeinwesen West so weit umkrempeln mussten, dass sie auch nach der Vereinigung mindestens vorläufig keine Gefahr für die Freiheit ihrer Nachbarn und der im Land lebenden Minderheiten darstellen, ist dennoch mehr als ein Glücksfall. Zu danken wäre jenem amerikanischen Präsidenten, der entgegen der Legende kein Berliner sein wollte und Politikern vom Schlage einer Margret Thatcher, deren Beinahe-Veto gegen die Vereinigung von 1990 eine nachdrückliche Verwarnung für die Zeit nach dem Abriss darstellte.
Karl Nele (Bahamas 63 / 2011)
Anmerkungen:
- Timothy Garton Ash: Im Namen Europas, 1996, 277
- Werner Kilian: Der Mauerbau und seine Auswirkungen auf die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, in Heiner Timmermann (Hg.): 1961 – Mauerbau und Außenpolitik, 2002, 326
- Kilian: 312 f.)
- Ash: 93
- Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Deutschen Demokratischen Republik: Dokumentation zur Westberlinfrage, 1964, 15
- Deutschland Archiv 6/2011, nach www.bpb.de/themen/UD6WIT.html
- Winfried Halder: Deutsche Teilung, 2002, 92
- Ulrich Buczylowski: Kurt Schumacher und die deutsche Frage, 1973, 27
- Halder: 201
- Buczylowski: 106
- Buczylowski: 163
- www.zeit.de/2002/24/200224_a-ddraufruestung_xml
- Ash: 332
- Ash: 34
- vgl. Norbert Frei: Deutsches Programm, in Die Zeit 23/2002
- Nobert Frei: Vergangenheitspolitik, 1999, 19
- ebenda: 39
- ebenda: 156
- ebenda: 211
- Friso Wielenga: Vom Feind zum Partner, 2000, 48
- ebenda: 49
- ebenda: 239
- Frei: Vergangenheitspolitik, 303
- Wielenga: 240 f.
- Charlotte Wiedemann: Rückkehr nach Deutschland, in Klaus Bittermann: Gemeinsam sind wir unausstehlich, 1990, 82
- Ash: 101 f.
- Ash: 121
- Ash: 135
- Ash: 429
- Ash: 282
SPALTE3-AKTUELL-RUBRIK
Frühere Aktivitäten sind im Aktuell-Archiv aufgeführt. Dort gibt es auch einige Audio-Aufnahmen.
Alle bisher erschienenen Ausgaben der Bahamas finden Sie im Heft-Archiv jeweils mit Inhaltsverzeichnis, Editorial und drei online lesbaren Artikeln.