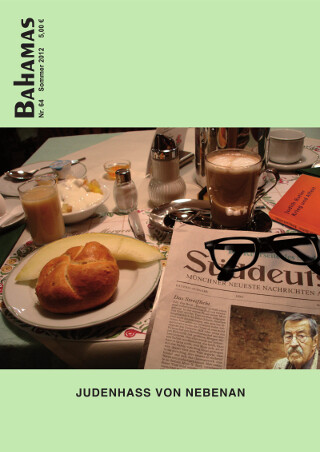Bereitschaft zu allem
Der engagierte Intellektuelle als Prototyp für ganzheitlichen Arbeitsterror
In Deutschland läuft vielfach das Engagement auf Geblök hinaus, auf das, was alle sagen, oder wenigstens latent alle gern hören möchten. (T. W. Adorno)
I.
Engagement ist ein Unwort geworden: ein Imperativ, der sich längst nicht mehr gegen den Terror der Gesellschaft richtet, sondern im Gegenteil diesen Terror exekutiert: Als „Terror auf Taubenfüßen“, der darin besteht, dass man das, was man ohnehin muss, auch obendrein noch mit allen Fasern zu wollen habe.
Engagement steht heute für das Verschmelzen von Arbeit und Alltag im Zeichen von äußerstem Leistungswillen und – auch: körperlicher – Bereitschaft zu allem und jedem; Engagement meint den hemmungslosen Dezisionismus des Überflüssigen, den unbedingten Willen, jeden noch so großen Unfug als Praktikant, Volunteer, Trainee mit sektenartiger Hingabe und unermüdlichem Fleiß mitzumachen, irgendeine Form der Anstellung schließlich als Erfüllung und zugleich endlose Fortschreibung einer qualvollen Initiation zu akzeptieren. Engagement ist nichts Freiwilliges mehr, sondern Resultat der Panik und dies umso mehr, wenn der Charakter der ausgeübten Tätigkeit dem, der sie manisch ausübt, die Überflüssigkeit direkt widerspiegelt: Und das tun in ganz besonderem Maß die Jobs, die, wie es in Witzen so treffend heißt, irgendwas mit Medien und Kommunikation zu tun haben, irgendetwas also aus dem Bereich, der von betrieblicher Weiterbildung über Marketing bis zu Ratgeberliteratur reicht.
Panisches Engagement nimmt also, wenn auch unbegriffen, die von der Ahnung bis zur schweigenden Gewissheit gereifte Erfahrung der potentiellen Überflüssigkeit aller auf, eine Erfahrung, die die Gesellschaft der Bürger historisch zunächst in die der Banden übergehen ließ, die wiederum zunehmend in ein amorphes und volatiles Geflecht aus Kleinst-Cliquen zu zerfallen scheint. Denn tatsächlich gilt mehr denn je, was Horkheimer in „Die Juden und Europa“ festhielt: dass nicht der ziellose Mechanismus des Marktes über das Wohlergehen der Einzelnen mehr entscheidet – ihnen also die „Ehre antat, sie als Personen zu ignorieren“ –, sondern dass eben die Cliquen darüber entscheiden, wer zu ihnen gehören darf und wer nicht – und das nicht mehr nach Kriterien von Nützlichkeit, sondern nur noch nach denen von unbedingter Willigkeit und schließlich nur noch nach dem Gesichtspunkt der mentalen Gleichartigkeit: „Der Urteilsspruch des Marktes darüber, wie jemand leben darf, der Spruch über Wohlsein und Elend, Hunger und Macht, mit dem auch die herrschenden ökonomischen Gruppen immer zu rechnen hatten, (wird) jetzt von ihnen selbst gefällt“, notierte Horkheimer (1). Und auch wenn es derzeit nicht um Weiterleben oder Ermordetwerden geht, hat sich im Nachkriegs-Korporatismus an diesem Zustand prinzipiell nichts geändert: Rechtzeitige Initiation in die Apparate, um dann dort das richtige Verhältnis aus Abgefeimtheit und Devotion zu treffen; das entscheidet über die Vergabe der Lebenschancen viel mehr als es Ideen oder Talent je vermöchten (Ausnahmen aus der Pionierzeit der digitalen Revolution bestätigen nur mehr diese Regel).
Arbeit ist der neue Sex
Von dort, wo diese Neo-Feudalität von Clan und Zunft sich stets schon ungebrochen zeigte, also in Universität und öffentlicher Verwaltung überhaupt, hat sie längst übergegriffen in die Welt auch der (zumindest der Rechtsform nach) privat organisierten Arbeit. Eine mediale Stichprobe aus der Vorweihnachtszeit beispielsweise zeigt, wie ganzheitlich Arbeit geworden ist; ganzheitlich in dem Sinne, dass sie, wie es der Jargon der Eigentlichkeit schon lange souffliert, „den ganzen Menschen“ fordert und nicht nur im Vorab bestimmte und bestimmbare Quanten seiner Arbeitskraft: Am Kiosk titelte der Stern (14.12.2011) mit der Schlagzeile „Arbeit ist der neue Sex! Millionen Deutsche arbeiten mit Lust und Hingabe“, während unmittelbar daneben der neue Focus-Ableger Focus Schule. Das Magazin für engagierte Eltern Motivationsprobleme von Kindern mit pseudowissenschaftlichen BWL-Trainingsmethoden anzugehen versprach und dabei einhämmerte: „Motivation ist für den Erfolg viel wichtiger als Talent“.
Zur selben Zeit gibt es für Zwölfjährige als Service der Hauptschule die ersten Bewerbungstrainings, während ein kurzes Blütensammeln in den Stellenanzeigen aus dem Sektor Dienstleistungen erbrachte, dass kaum eine dieser Ausschreibungen ohne natürlich „Engagement“, aber auch „Begeisterung“, „Enthusiasmus“, „Eigeninitiative“ oder „überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft“ auskam. Oft verschwamm denn auch die Grenze zwischen Stellenanzeige und Sektenanwerbung: „Identifikation mit dem Produkt“ wurde da gefordert und auch „Hingabe ans Team“. Den Vogel schoss eine Mannheimer Agentur für Unternehmenskommunikation ab, die Bewerbern eine „musketiermäßige Atmosphäre“ verhieß. Wie man sich die vorstellen darf, war kürzlich in der Welt-Beilage Junge Profis (24. 3.2012) nachzulesen, in der ein Henrik Berggren, Gründer des Berliner Internet-Unternehmens Readmill, einer Plattform für so genanntes „soziales Lesen“, Einblick in sein Leben und auch das seiner Kollegen gab: „Unser Büro soll auch ein Ort sein, an dem unsere Mitarbeiter Wochenenden verbringen wollen, Bier trinken und eben tolle Arbeit leisten“, textete der Engagierte da und sagte weiter: „Ich finde den Begriff Work-Life-Balance völlig sinnlos […] wenn dieser Unterschied für einen nicht existiert“.
Man merkt schon: Hier spricht der Unternehmer nicht als Nachfahre der dicken, Zigarre rauchenden Bonzen der kommunistischen Karikatur, sondern hier spricht er als Nachfahre der Lebensreformer der Vorkriegszeit und erst recht als Epigone der Alternativen der Nachkriegszeit, vor allem jener Ideologen der selbst verwalteten Betriebe, die persönliches Leben und ökonomisches Überleben zusammen zwingen sollten. Mit der Konsequenz natürlich, dass damit genau jenes Selbst wiederum das Betriebskapital bildete und letztlich verkaufbare Qualifikationen die Grenzen der möglichen Entfaltung der Person bildeten. Die so erfolgende Umetikettierung des Reichs der Notwendigkeit zu dem der Freiheit beschädigt nicht nur dessen Begriff, sondern sogar dessen Möglichkeit überhaupt: Freizeit im wörtlichen Sinne nämlich, und dies umso mehr, weil die totalitäre Attacke auf die Zeit, die nicht Arbeit ist, eben im Namen der Freiheit gefahren wurde und wird.
„Engagier Dich!“ war das Motto des selbst verwalteten Arbeitens, das wiederum seine politische Legitimation aus der Protestbewegung zog, die genau dieses Engagement zum Gradmesser dessen gemacht hatte, wie aufrichtig einer es mit der Revolution, dem Sozialismus oder wenigstens dem „anderen Leben“ oder der „konkreten Utopie“ meinte. So gehörte bei etlichen Alternativbetrieben Westberlins die Verpflichtung zum politischen Engagement auch außerhalb der Arbeitszeit zu den Kernanforderungen an die Belegschaft, die nicht aus Kollegen, sondern Gesinnungsgenossen zu bestehen hatte.
So recht wahrhaben haben wollten die Engagierten damals schon nicht, dass bereits in den Sechzigern einer der scheinbar Wankelmütigen und allzu zart Besaiteten, Adorno nämlich, an „die Schwäche in der Konzeption des Engagements“ erinnert hatte, weil „manche seiner Parolen von seinen Todfeinden nachgeplappert werden (könnten). Dass es um Entscheidung an sich gehe, würde sogar das nationalsozialistische ‚Nur das Opfer macht uns frei’ decken; im faschistischen Italien hat Gentiles absoluter Dynamismus auch philosophisch Verwandtes verkündet.“ (2)
Die Mobilmachung von links scherte sich um derlei Einwände nicht und erfasste im Lauf der Jahre Lehrpläne, Schulen, Kindergärten und schließlich die normale Mittelstandsfamilie und damit einen Großteil aller Kinder und Jugendlichen: Denn die Leser, auf die Focus Schule setzt, also die Eltern der heutigen Projekt-Lerner, Praktikanten und Trainees haben diese Schule des Engagements, die die Protestbewegung und ihre ökopazifistischen Degenerationsprodukte bildeten, durchlaufen. Im bösen Sinne hat hier also wirklich ein theoretisches Konzept, das des engagierten Intellektuellen, die Massen ergriffen und ist zur materiellen Gewalt geworden.
Und das nicht von ungefähr: Die Tendenz zum Zwang trug dieses Konzept schon in sich, als es noch – wie vor Jahrzehnten – als Voraussetzung gesellschaftlicher Befreiung, sei es die des Proletariats oder gleich die des Menschen an sich, gefeiert wurde: Lief es doch immer darauf hinaus, dass die Außenwelt als einziger Aktionszwang wahrgenommen werden sollte, als bloßer Stimulus subjektiver Erregung und damit als Handlungsgebot; ein Gebot, das eigentlich ja mit dem antiintellektuellem Ressentiment verschwägert ist, duldet es doch keine Schwäche, Widerwillen oder wenigstens einen Moment der Besinnung. Die Rolle des Intellektuellen führte so notgedrungen ins Dauer-Pamphletieren, dem Vorläufer heutiger Projektarbeit mit ihren unzähligen Sitzungen und Memoranden und Prototyp des so genannten bürgerschaftlichen Engagements: Man dürfe nicht wegsehen, hieß es damals, man müsse thematisieren, man habe wachzurütteln, zu mahnen, zu gedenken, zu fordern, zu agitieren, zu unterschreiben – tunlichst ohne Unterlass (3).
II.
Dabei hatte lange wenig darauf hingedeutet, dass ausgerechnet aus dem Reservat, das die an die Macht gelangte bürgerliche Klasse zunächst ihren professionellen Intellektuellen zugestanden hatte – etwa zu Zeiten Friedrich Schillers –, dereinst der Prototyp des rundum mobilisierten Dienstleistungs-Arbeiters des postfordistischen Zeitalters entstehen sollte. Denn die bestimmenden Kennzeichen des Intellektuellen waren ursprünglich die distinktive Selbstbeschränkung, der ostentative Verzicht darauf, sich noch in die Tagesgeschäfte der politischen Ausschüsse des Bürgertums einzumischen, und die kokette Ohnmacht, die sich auf den Bereich der Kultur beschränkt, sich dem Wahren, Guten und Schönen, also der ästhetischen Erziehung des Menschengeschlechts widmet, nachdem die politische im kapitalen Alltag versandet war.
Und dennoch lag in dieser Ohnmachtserfahrung, die die Grundlage der Selbststilisierung der Intellektuellen zu der Masse und dem Alltag enthobenen Kündern der idealen Menschheit bildete, der Vorschein der realen Ohnmacht, zu der die Selbsttätigkeit der erweiterten Akkumulation des Kapitals alle seine Charaktermasken über kürzer oder länger verurteilen sollte. Und so folgte mit einiger Notwendigkeit auf Schiller Schopenhauer: Gerade dessen misanthropische und schlussendlich sogar die Selbsterhaltung negierende Ablehnung jeglicher Partizipation an der vom agonalen Prinzip bestimmten Welt, seine fast schon fernöstlich anmutende Reduktion der Bedürfnisse und der Verzicht auf möglichst jede Willensäußerung, können gedeutet werden als ein Zeichen äußerster Anpassungswilligkeit an die Verwertung des Werts, die dem Materiellen und damit dem Seienden höchst abhold ist; als Einpassung also in einen ewigen Zirkel, der immer nur transitorisch und widerwillig stoffliche Gestalt annimmt, um diese dann möglichst rasch wieder ins per se gestaltlose allgemeine Äquivalent aufzulösen.
Diese Bereitschaft zum Nichts, die Schopenhauer in endgültiger Abkehr vom Schillerschen ästhetischem Moralismus verkündete und forderte – und deren durchschlagender akademischer Erfolg die darin chiffrierte Ohnmachtserfahrung der gesamten bürgerlichen Klasse belegt – barg aber zugleich in sich die Bereitschaft zu allem. Schopenhauers Verzicht auf den Willen setzte nicht diesen außer Kraft, sondern bereitete den Boden dafür, dass dem Willen seine Objekte und Ziele gleich geltend und gleich gültig wurden. Also: den Boden für das „Jenseits von Gut und Böse“, „für die Umwertung aller Werte“, für die Ablösung des Willens von der moralischen Prüfung, den Boden für Nietzsche, dessen „Philosophie mit dem Hammer“ den Übergang vom Kartell-Kapitalismus in den autoritären Staat intellektuell aufbereitete.
Denn dieser griff als willentlicher Akteur in das bis dato wenigstens auf dem Papier freie Spiel der Kräfte ein, setzte dem anonymen Austausch Grenzen, Regeln und Ziele, gab den Staatsbürgern Rechte und Pflichten auf, die sie als Tauschbürger nie besessen hätten noch hätten erfüllen müssen. Waren die Reservate der Intellektuellen bislang die kultivierte Zugabe bürgerlicher Machtausübung, hingen sie somit vom Geschäftsgang ihrer Familien wie den Launen und Finanzmöglichkeiten der Landesfürsten ab, so schienen sich mit der zunehmenden staatlichen Regulation ganz neue Beschäftigungsfelder für Intellektuelle abzuzeichnen: Felder, die der Macht nahe lagen, ja, die einem selber die praktische Illusion des Planens, Lenkens und Formens geben konnten, eine Verkehrung der bisherigen Verhältnisse: Jetzt schien das Schicksal der Industrie vom Handeln der staatlichen Bürokratien abzuhängen und nicht mehr umgekehrt; es wollte so aussehen, als habe die Stunde einer „Aristokratie neuen Typus“ (Enderwitz) (4) geschlagen, deren hohes Lied eben Nietzsche sang – und der deshalb seither periodisch immer wieder aus dem geistigen Tornister der Intellektuellen hervor geholt wird.
Was diesen neuen Menschen auszeichnen sollte, so Nietzsche, wäre sein uneingeschränktes Bekenntnis zum Willen – und zwar zum unbeschränkten. Er stellt den vitalen Elan dar, der nicht durch „Sklavenmoral“, durch christliche Rücksichten etwa, in seiner gestalterischen wie zerstörerischen Kraft gebremst werden dürfe; ein Bekenntnis zur Macht als dem Demiurgen des Weltgeschehens und ein Bekenntnis derer, die sich berufen glauben, diese Macht denn auch auszuüben; eine zwar phantasmagorische, aber nicht grundlose Verkehrung der bisherigen Machtverhältnisse zwischen dem Bildungs- und dem Erwerbsbürger, dem intellektuellen und dem pragmatischen Teil des Bürgertums, die den ersten zum Leiter, Richtungsgeber und Nutznießer der Veranstaltung erklärt, während der zweite – gemeinsam mit dem Proletariat – nur schlicht dafür zu sorgen habe, dass die Veranstaltung namens Erweiterte Reproduktion des Kapitals stets weiter geht. Jenem zweiten Teil, der großen Masse des Plebs aus „Sklavennaturen“, geht naturgemäß, aufgrund ihrer material-egoistischen Beschränkung der Blick fürs Ganze ab, den Nietzsche und seine begeisterten Adepten bis heute für die dem ökonomischen Prozess enthobenen Intellektuellen reklamieren. Tatsächlich ist der Widerwille gegen die Zwänge des „bloß Ökonomischen“ der Tenor intellektueller Gesellschaftskritik geblieben: Eine Kritik, die nicht dem stummen Zwang der Verhältnisse an sich gilt, sondern nur der Tatsache, dass diese Verhältnisse sich allzu oft einfach nicht fügen wollen ins etatistische Selbstverständnis einer Intellektuellenschicht, die, weil sie das leitende Personal der staatlichen Bürokratie stellt, sich auch tatsächlich für den Staat hält. Nietzsches Geißelungen der Geldsäcke und Krämerseelen wirken so durch all die zahllosen Suaden hindurch, die die Beschränkung des Geistes und der Kultur durch Mammon und Ökonomismus beklagen (5), die also aktuell besonders gern darüber lamentieren, dass der vermeintliche Ideenüberschuss Europas so gar nichts vermag gegen die tatsächliche Unterfinanzierung seiner Staatshaushalte.
III.
Diese vitalistische Kehre der Intellektuellen, also derer, die zuständig sind für die Produktion von Ideologie im weitesten Sinne – vom Schulunterricht über Strategiepapiere bis zum Aufführen von Theaterstücken –, das siegesgewisse Eintreten in die Arena des Willens zur Macht, fällt in eins mit dem Ende des liberalen Zeitalters. So verrückt Nietzsches Anmaßung definitiv ist – zumal sie den Herrenmenschen ja nicht als gehobenen Bürokraten, sondern als distinguierten Konsumenten entworfen hatte –, so sehr nimmt sie auch ein reales Verrücken der Kräfteverhältnisse in sich auf: dem von den Ausschüssen des Produktionsbürgertums hin zu den Bürokratien des aktivierten Staates.
Seinen tatkräftigen Willensmenschen denkt Nietzsche nämlich nicht als Rückkunft des Muskelbarbaren der Vorzeit und lehnt ihn auch nicht am Vorbild des untergegangenen Aristokraten an, sondern er zeichnet ihn genau als Inhaber jener Soft Skills, die in den Apparaten von Staat und auch Massenorganisationen aller Art Grundlage des Erfolges, ja überlebensnotwendig sind (und deren Beherrschung erst recht für die Initiation in die heutigen Dienstleistungs-Rackets unabdingbar ist). Enderwitz’ Aufzählung ist da nicht viel hinzufügen: „Nicht mehr einfache Körpertüchtigkeit, offene Gewaltbereitschaft und geradlinige physische Durchsetzungskraft zeichnen den Aristokraten neuer Prägung aus, sondern hoch entwickelte geistige Beweglichkeit, die Fähigkeit, objektiven Druck und heimlichen Terror auszuüben, und die Beherrschung komplizierter psychischer Manipulationsmechanismen […] Wo der Herrenmensch alter Schule nur sich selbst und seine Waffen hat […] da wird dem Herrenmenschen neuer Fasson die ganze Welt ineins zur Bühne und zur Waffe, um gleichermaßen auf und mit ihr seine als sublimes psychologisches Kräftemessen und virtuose intellektuelle Spiegelfechtereien zelebrierten Machtspiele auszutragen“ (6).
Doch so sehr die Intellektuellen und die Apparate von Staat und Massenparteien wie füreinander gemacht schienen, so sehr benötigten sie auch eine Legitimation, die sie nicht aus sich selbst schöpfen können: Sie müssen handeln nicht nur zu ihrem eigenem Besten, sondern in sozialer Vertretung. Und da bot sich nun keineswegs das ermattete und als egoistisch gebrandmarkte Bürgertum an, sondern vielmehr das unverbrauchte Proletariat, dessen Organisationen mit ihren Forderungen nach dem „Volksstaat“ und der „Diktatur des Proletariats“ den Primat des Staats über die Ökonomie zum Programm erhoben hatten. Also stellte eigentlich das Proletariat – oder in der Terminologie der rechten Variante des engagierten Intellektuellen: „der Arbeiter“ – den idealen Bündnispartner oder besser: Erfüllungsgehilfen dar: Mussten die Massen nicht eigentlich, wie man selber auch, danach streben, sich aus den Demütigungen und Kränkungen zu befreien, die die unpersönliche Bewertung durch den Markt bereithielt: im schlimmeren Falle als Überflüssig-Erklärung oder im besseren als Einweisung in die prekäre Subventionierung?
Dass viele Jahrzehnte später, in der einsetzenden Abenddämmerung des realen Sozialismus, ungarische Intellektuelle dieses Substitutionsbündnis mit dem Schlagwort „Die Intelligenz auf dem Weg zur Klassenmacht“ belegten und es gar als „bestimmendes Merkmal der sozialistischen Gesellschaft“ angaben, machte zu später Stunde doch offenbar, worum es sich beim Bolschewismus – rein aus der Warte der Soziologie betrachtet – gehandelt hatte, und warum eine zu sozialer Aktivität erwachte Intelligenz sich so über alle Maßen für ihn eingesetzt hatte (und das meistenteils aus völlig freien Stücken). Ebenso trocken wie naseweis hielten György Konrád und Iván Szelényi nämlich fest: „Damit also die Idee des wissenschaftlichen Sozialismus zum unmittelbaren Programm der intellektuellen Klassenmacht werden konnte, musste sich die sozialistische Bewegung gerade unter den gesellschaftlichen Verhältnissen Russlands zum Bolschewismus entwickeln“ (7).
Doch einen solch realistischen Blick konnte erst das Ende auf den eigenen Anfang werfen, realistisch insofern, als nämlich das Projekt „Neuer Mensch“ deckungsgleich mit der Erhebung und Ermächtigung der Intelligenz zur eigenen Gesellschaftsklasse war. Doch der partikulare Machtgewinn als zunehmend selbständiger Klasse war für die Intelligenz nicht das Motiv zum Bündnis mit der proletarischen Ideologie, sondern dessen Resultat, das in der großen Desillusionierung der Nach-Stalin-Zeit dann nackt zu Tage lag.
Motiv war vielmehr die Verlockung der eigenen Teilhabe an einem Willen, der die Welt formt, der den tatsächlichen, seelen- und körperlosen Willen des sich verwertenden Werts entkräftet, der, mit anderen Worten, die Kränkung durch Ausschluss des autonomen Subjekts aus der Entscheidung über sein gesellschaftliches Leben (den die Bildungsbürger ja als erste Fraktion ihrer Klasse verspürten und geistig bearbeiten mussten) kompensiert; also eines Staat gewordenen Willens, der überschreit, was er doch selbst als autoritärer Staat exekutiert: die Ohnmacht aller.
Dieses Konzept des Staat gewordenen Willens greift auf die Urquellen bildungsbürgerlichen Selbstverständnisses zurück, nimmt Rache an der liberalen Verachtung für die professionellen Ideologen und betreibt doch im Schein der äußersten Freiheit des Gestaltungswillens der Bürokratie und der Partei die totale Unterwerfung, die der integrale Etatismus ist. (8) Dessen Attraktivität für den engagierten Intellektuellen ist also nicht akzidentiell und persönlichen oder zeitbedingten Moden unterworfen, sondern Erkenntnis der Gleichartigkeit von Selbstdefinition einerseits und Staatsraison andererseits: Beide eint die Aufgipfelung reiner und absoluter Subjektivität, die objektive Schwierigkeiten oder Schwächen der empirischen Subjekte unter sich lässt, beide eint die Gier nach dem Sieg des subjektiven Willens über die objektive Unmöglichkeit: Das aber genau wäre die treffendste Definition des Stalinismus, dass es nämlich nur auf den einzelnen ankomme, dass seine Opferbereitschaft alles im positiven Sinne, sein Verrat aber auch alles im negativen Sinne entscheide.
Stalin war so nur der oberste Demiurg, der, wie Boris Groys es formulierte, „Künstler-Tyrann“, der das gesamte Alltagsleben mit eben „stählernem Willen“ einem Gesamtplan unterwarf, dem alle Parteimitglieder und alle Sowjet-Menschen sich anzuähneln hätten. Der Staat wurde zum Gesamtkunstwerk, der „neue Mensch“ sein Inhalt. Im Zeichen ihres welthistorischen Engagements büßte Kunst ihre Autonomie vollends ein (darin war der sozialistische Realismus absolut „progressiv“) und widmete sich allein noch dem Monument und dem Heros: „Ein charakteristischer Zug der literarischen Helden der Stalinzeit ist ihre Fähigkeit zu Ruhmestaten, die menschliche Kräfte offensichtlich übersteigen – und diese Fähigkeit verdanken sie ihrer Weigerung, dem Leben ‚formalistisch‘ zu begegnen. Die Weigerung setzt sie in den Stand, allein durch die Willenskraft die Tuberkulose zu überwinden, ohne Treibhäuser tropische Gewächse in der Tundra zu züchten, mit der bloßen Kraft des Blicks den Feind zu paralysieren usw.“ In der Realität „(erhöhte) die Stachanow-Bewegung die Arbeitsproduktivität ohne jede Anwendung zusätzlicher Hilfsmittel, allein durch Willensanstrengung der Arbeiter, um das mehrere Dutzendfache […] Zur Losung der Zeit wurde: ‚Einem Bolschewiken ist nichts unmöglich.‘ Jeglicher Verweis auf Fakten, technische Möglichkeiten und objektive Grenzen wurde als ‚Kleinmut‘ und ‚mangelnde Zuversicht‘ behandelt, die einem wahren Stalinisten nicht anstanden“ (9).
Der „Personenkult“, den der XX. Parteitag 1956 so vordergründig beklagte, hatte – anders als Nikita Chruschtschow sich und anderen glauben machen wollte – nichts mit der empirischen Person Stalins zu tun, sondern damit, dass Stalin als eine Art lebende Utopie das schlagende Exempel für die Welt verkörperte, was der Wille vermag: nämlich alles. Stalinismus ist der totalisierte Voluntarismus und zugleich eine postapokalyptische Hommage an Nietzsche: denn im Stalinschen Paradies der Werktätigen setzte sich nicht mehr der eine Wille gegen den oder die anderen durch, sondern alle gingen in einem auf, dem der proletarischen Partei, des Kommunismus und seines „obersten Wachhabenden“. Er und die, die ihm sich gleich machten, konnten jegliche Fessel irdischer Notwendigkeit durch freie Tathandlung kappen. Der „neue Humanismus“, den Stalin seine Ideologen und Künstler predigen ließ, hatte nichts Geringeres im Auge als die Verallgemeinerung des von Nietzsche noch elitär angelegten „Übermenschen“.
In der Konstitution dieses „neuen Menschen“, des gelebten Wunschtraums von beileibe nicht nur sowjetischen Künstlern und Intellektuellen, waren neben Nietzsche auch die beiden anderen ideologischen Charakteristika aufgehoben, die den politischen Charakter und das soziale Selbstverständnis des Bildungsbürgertums bislang geprägt hatten: Die in der Weltabkehr Schopenhauers verpuppte Bereitschaft zu allem und auch der mit Pathos geladene Glaube an die ästhetisch-kulturelle Erziehungsaufgabe der Kultur, der auf Schiller und seine „Schaubühne als moralische Anstalt“ zurück verweist.
Als unsinnig erweist sich damit die Frage, wie nahe oder wie fern Stalin die engagierten Dichter, Philosophen etc. jener Jahre standen, die sich vom Abstellgleis der bürgerlichen Gesellschaft und damit ihre Tätigkeit von der Wirkungslosigkeit im Feuilleton befreit hatten eben durchs Engagement für die Sache des Volkes, des Arbeiters oder des Proletariats. Die diesbezüglichen Debatten im Bereich der engagierten Kunst gehen am Kern der Sache vorüber: Stalin war Fleisch von ihrem Fleische, der Stalinismus äußerste Konsequenz des Willens zum Engagement. Ja, man ist versucht zu behaupten, dass für fortschrittlich gestimmte Intellektuelle am Stalinismus kein Weg vorbeiging, sofern sie nicht bereit gewesen wären, das skizzierte Konzept des Engagements selber zu kritisieren. Das aber hätte wiederum bedeutet, rein negativ zu bleiben, gar noch die westlichen Rudimente des gehassten Liberalismus zu verteidigen und auf das zu verzichten, was das Engagement so anziehend machte: Neben – zumindest glaubhaft eingebildeter – politischer und administrativer Bedeutung im autoritären Staat dürfte es in erster Linie und vor allem die Aura des Künders eines neuen Menschen und eines neuen Lebens gewesen sein, die so unwiderstehlich lockte.
Der einzelne Allgemeine
So nämlich konnte sich der Intellektuelle auch und gerade bei der immer offensichtlicher werdenden Krisis des Proletariats als revolutionärem Subjekt, als vorläufiges Ersatzsubjekt der Weltgeschichte fühlen, als derjenige, der vorlebt oder zumindest vorträgt, wie Engagement geht – und der seinen Anspruch durch die antikolonialen Revolutionen weiterhin gedeckt wähnt, so wie zuvor durch den Roten Oktober: 1965 beispielsweise stilisierte ein existentialistischer Schriftsteller in einem Plädoyer für seinen Berufsstand sich und seinesgleichen zu „einzelnen Allgemeinen“, die die Leser erst über ihr „In-der-Welt-Sein“ informierten: „Da er [der Intellektuelle; U.K.] weiß, dass er noch nicht Mensch ist, gilt es, in sich und außerhalb von sich, den neuen Mensch zu schaffen“ (10). Der Stalinismus im Konzept währt fort, auch ohne dass der Name Stalins noch vorkommen würde. Den muss auch Adorno in seiner Kritik nicht nennen, im Vorwort der Negativen Dialektik genügt der Fichtes vollkommen: „Wie für Fichte ist für den Existentialismus jegliche Objektivität gleichgültig […] Die Vorstellung absoluter Freiheit zur Entscheidung ist so illusionär wie je die vom absoluten Ich, das die Welt aus sich heraus entlässt […] Das absolute Subjekt kommt aus seinen Verstrickungen nicht heraus: die Fesseln, die es zerreißen möchte, die der Herrschaft, sind eins mit dem Prinzip absoluter Subjektivität“ (11).
IV.
Weder die Krise des integralen Etatismus noch die des doch zu vertretenden Proletariats konnten also dem Konzept: Engagierter Intellektueller ist gleich neuer Mensch etwas anhaben. Im Gegenteil, gerade diese Krisen erweisen, dass dieser neue Mensch weniger durch politisierte Kunst und Staatsterror geschaffen wird, sondern mehr durch die schlichte, zur stillen Panik gesteigerten Angst vor der eigenen Überflüssigkeit. Der Kultus des Willens war eben schon immer zuerst ein Kultus der Willigkeit.
Der Existentialismus war dessen politisch-philosophischer Vorschein, indem er das Engagement zur menschlichen Tugend an sich erhob, es nicht mehr unter der Maßgabe eines vom Subjekt noch zu wählenden Gegenstandes betrachtet, sondern als allgemeinen Modus, in dem der Mensch erst zum Menschen wird. Engagement ist demnach ein Existential, gehört eben keinem konkreten Objekt, einem Seienden an, sondern bildet das Wesen des Seins schlechthin. So „menschlich“ konzipiert werden Proletariat und Weltrevolution verzichtbar, und selbst die „konkrete Utopie“ oder das „andere Leben“, die als Surrogate zunächst den Verlust der großen Ziele kompensieren, werden unnötig: Im „post-ideologischen Zeitalter“ schließlich muss sich Engagement nicht mehr auf eine bessere oder andere Zukunft beziehen, sondern begründet sich selbst als Ethos einer allumfassenden Leistungsbereitschaft, die jeden Bürotag so ansieht wie einst Stachanow den Fünfjahresplan. Aus einer auf acht Stunden begrenzten Abspaltung des Alltags ist Arbeit zur ganzheitlichen Verpflichtung geworden, ohne dass es dazu noch der Ermunterung durch Philosophen oder Bolschewisten bedürfte; deren Rolle nehmen heute Coaches für alles und jedes ein. Sie predigen zwar eine säkularisierte Form des Engagements, die Subjektivität bleibt aber absolut wie je. In ihrem Bannkreis darf es nichts Fremdes, Sachliches und Kühles geben: Marketing-Konzepte werden gelebt, Geschäftsideen werden geliebt, Produkte entspringen Philosophien, kurz: Die Veräußerung der Arbeitskraft wird verinnerlicht als Seinserfüllung, Distanz wird nirgends geduldet – weder bei der Arbeit noch von der Arbeit.
Herbert Marcuse hatte diesen Zustand bereits ins Auge gefasst, lange bevor er tatsächlich eingetreten war. Am Ende von Der Eindimensionale Mensch notierte er: „Beängstigend (ist) die organisierte Anstrengung, das ureigene Recht des Nächsten nicht anzuerkennen, Autonomie selbst in einer kleinen, reservierten Daseinssphäre zu verhindern.“ Und weiter: „Die Expansion in allen Formen der Zusammenarbeit, des Gemeinschaftslebens und Vergnügens (ist) in den Innenraum der Privatsphäre eingedrungen und hat praktisch die Möglichkeit jener Isolierung ausgeschaltet, in der das Individuum, allein auf sich zurückgeworfen, denken, fragen und etwas herausfinden kann“ (12).
Wie sehr gilt das jetzt erst, da mittlerweile selbst die Trennung von Arbeitsplatz und Wohnstätte obsolet geworden ist und die Beflissenen Freizeit im Zeichen universeller Bereitschaft so leisten, wie man es noch vor einen halben Jahrhundert kaum einmal von der Akkord-Arbeit kannte. Verbissene Pseudoaktivitäten bereiten Körper und Geist auf den so unerbittlichen wie eigentlich längst unnötigen Überlebenskampf vor; und das nicht allein in Trend- und Renommiersportarten, nein, auch das, was unter Entspannung und Wellness firmiert, gleich ob Yoga, Kräuterdampfbad oder Pilgerreise, wird zur Etappe der großen Mobilisierung auch noch der letzten Reserven.
Was folgt daraus? Zunächst, einmal mehr, nur eine negative Erkenntnis: Dass es nämlich widersinnig wäre, der engagierten Gesellschaft noch mehr Engagement entgegensetzen zu wollen; dass Opposition in der mobilisierten Welt eher die Lustlosigkeit bedeuten könnte, das Sich-Nicht- Mitreißen-Lassen. Sich bei Bedarf auch artikulierende Unlust wäre sicher widerborstiger als die Pose der intellektuellen Stellvertretung verblendeter Massen oder die zeitgemäße Nachfolge-Pose des einsamen Kritikers, der schwerwiegende Entscheidungen gegen den Massen-Konsens zu treffen hätte. Um gleich Missverständnissen vorzubeugen: Das heißt natürlich nicht, sich diesem Konsens einzufügen; ganz im Gegenteil, hieße es, nicht auf „kritische“ Weise nachzuäffen, wie dieser Konsens zustande kommt, konkret: nicht in eine Miniaturausgabe der Rolle der öffentlichen Vorzeige-Bedenkenträger zu verfallen, so zu tun also, als ob es auf einen ankäme. Kritik würde also nicht Mit-Buhlen, nicht Mit-Gockeln heißen, sondern Kritik müsste vielmehr offen auf der Privatheit ihrer Motivation bestehen.
Und so wäre übrigens denn auch eher die charakterliche Statur desjenigen beschaffen, auf den auch unter totalitärer Herrschaft Verlass sein könnte, folgt man Hannah Arendts diesbezüglichen Überlegungen. Nicht die, die die öffentliche Pose brauchen, werden es sein, auch nicht die besonders Mutigen wahrscheinlich, sondern die, die nicht zur Veräußerlichung wenigstens des Restbestandes ihrer privaten Autonomie bereit sind, weil sie es im Zweifelsfall sein werden, die Wert darauf legen, nicht mit einem zusammenzuleben, der Dreck am Stecken hat – sich selber nämlich. Hannah Arendt schrieb: „Am allerbesten aber werden jene sein, die wenigstens eins genau wissen: dass wir, solange wir leben, dazu verdammt sind, mit uns selber zusammenzuleben, was immer auch geschehen mag“ (13).
Uli Krug (Bahamas 64 / 2012)
Anmerkungen:
- Max Horkheimer: Die Juden und Europa, zit. nach: Wirtschaft, Recht und Staat im Nationalsozialismus, Frankfurt 1984, 48
- T.W. Adorno: Noten zur Literatur: Engagement, in: Gesammelte Schriften, Band 11, 415.
- Dabei gibt es keinen besseren Weg, Abstumpfung auszulösen, als das plakative Dauer-Engagement – und oft, so drängt sich der Verdacht auf, sind es gerade nicht die Sensiblen, sondern die eigentlich Empathielosen, die so gar nicht genug bekommen können von engagierten Filmen und Büchern, die sich auf eine sozial geduldete Weise nachgerade ergötzen an der Judenverfolgung als einer Art History-Thrasher für die verdrängte Lust am Bösen.
- Siehe zur immerjungen Nietzsche-Mode die Schrift von Ulrich Enderwitz: Der Konsument als Ideologe. 200 Jahre deutsche Intelligenz, Freiburg 1994, vor allem 126 ff. Wenn man von Enderwitz’ restriktiv konsumkritischer Intention absieht, zeigt er doch wichtige Aspekte des intellektuellen Selbstverständnisses in der neueren deutschen Ideologie.
- Dass der bislang letzte große Nietzsche-Kultus in den 1970ern bei französischen Links-Intellektuellen seinen Ausgang nahm, genau daher, woher auch der Ton der typisch bürokratisch-intellektuellen Globalisierungskritik stammt, kann aus dieser Perspektive nicht überraschen. Zur Sozial- und Mentalitätsgeschichte des postabsolutistischen Etatismus Frankreichs siehe Bahamas 50, Staat und Revolution, 15 ff.
- Enderwitz: a.a.O., 128 f.
- György Konrád und Iván Szelényi: Die Intelligenz auf dem Weg zur Klassenmacht, Frankfurt 1978, 112. Ganz deutlich werden sie an dieser Stelle „Eine unserer Grundthesen bei der Strukturanalyse der sozialistischen Gesellschaften ist, dass […] (nicht nur) jene Mitglieder der Intelligenzklasse kraft ihrer Amtsgewalt unmittelbar berechtigt (sind), über das gesellschaftliche Mehrprodukt zu verfügen, sondern all jene, die das Ethos der rationalen Redistribution schaffen, erhalten und zur umfassenden Ideologie der gesamtgesellschaftlichen Kultur erheben.“ (S.
- Trocken konstatierte Horkheimer: „Die konsequenteste Art des autoritären Staates, der aus jeder Abhängigkeit vom privaten Kapital sich befreit hat, ist der integrale Etatismus oder Staatssozialismus.“ In: Autoritärer Staat, 61, zit. nach: Wirtschaft, Recht und Staat im Nationalsozialismus, Frankfurt 1984
- Boris Groys: Gesamtkunstwerk Stalin, München 1988, 67
- J. P. Sartre: Plädoyer für den Intellektuellen, Interviews, Artikel, Reden 1950–1973, Reinbek b. Hamburg 1995, 111 f.
- T. W. Adorno: Negative Dialektik, Frankfurt 1975, 59 f.
- Herbert Marcuse: Der eindimensionale Mensch, Frankfurt 1978, 255
- Hannah Arendt: Die persönliche Verantwortung unter der Diktatur, in: dies.: Nach Auschwitz, Essays & Kommentare, Berlin 1989, 94
SPALTE3-AKTUELL-RUBRIK
Frühere Aktivitäten sind im Aktuell-Archiv aufgeführt. Dort gibt es auch einige Audio-Aufnahmen.
Alle bisher erschienenen Ausgaben der Bahamas finden Sie im Heft-Archiv jeweils mit Inhaltsverzeichnis, Editorial und drei online lesbaren Artikeln.