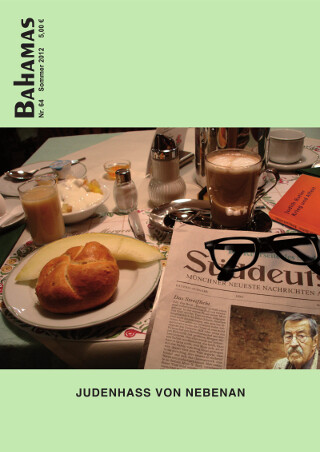Keine Bühne gegen Israel?
Vom Scheitern einer Kampagne
Gegen den Antisemitismus kann man nicht argumentieren, weil er nicht satisfaktionsfähig ist: Jede sinnvolle Argumentation setzt einen Gegenstand voraus, der sich mit den Mitteln der Vernunft erschließen lässt; der Antisemitismus jedoch entzieht sich dem Zugriff der Vernunft, weil er seinem Unwesen nach nichts anderes ist als rationalisierter Wahn. Das ist die Erkenntnis hinter Woody Allens Bonmot, wonach im Kampf gegen Antisemiten dem Essay der Baseballschläger vorzuziehen sei: Wo Argumente als Waffen stumpf sind, haben handfeste Waffen die bessere Aussicht auf Erfolg – der Umgang Israels mit seinen Feinden ist dafür das beste Beispiel. Eine Nutzanwendung auf die hiesigen Verhältnisse liefert dieser Gedanke jedoch kaum, denn Gewalt taugt hierzulande maximal dazu, ein paar Stiefelnazis in die Schranken zu weisen, sofern sie in Unterzahl sind. Gegen den Antisemitismus als Tendenz, im doppelten Sinne entsprungen aus Logik und Geschichte der modernen Vergesellschaftung, richten weder Argumente noch Baseballschläger etwas aus. Ein politisches Projekt, das Antisemitismus und Antizionismus praktisch entgegentreten will, kann deshalb unter gegebenen Umständen seinem Anspruch niemals gerecht werden: Es wird keine Mittel finden, seine Zwecke zu erreichen.
Dieser Befund ist weder neu noch originell – und für die „antideutsche“ Israelsolidarität, die um das Jahr 2000 herum aus der deutschen Linken hervorging, müsste er eigentlich verbindlich sein. Man war doch nicht zuletzt deshalb aus der Linken ausgestiegen, weil die Kritik, der man den Vorrang geben wollte, ihres Wahrheitsanspruches wegen mit der Bewegungspolitik und deren Ansprüchen auf Identitätsbildung und Anschlussfähigkeit nicht vereinbar schien. Umso erstaunlicher ist es, dass die Antideutschen nach Ausbruch der zweiten Al-Aksa-Initifada im Jahr 2000 und stärker noch nach dem 11. September 2001 den Vorrang der Kritik und die Israelsolidarität als politische Praxis gleichzeitig postulieren konnten, ohne dabei in ernsthafte Erklärungsnöte zu geraten. Anscheinend war es in der heißen Phase der Auseinandersetzungen mit der Linken, also bis zum Ende des Irak-Krieges 2003, möglich, diese Frage zu ignorieren. Vielleicht war das sogar nötig, um nicht handlungs- und kritikunfähig zugleich zu werden. Dennoch handelte es sich um einen Akt der Verdrängung, der nur um den Preis eines blinden Flecks im eigenen Konzept gelingen konnte. Die Folge ist eine gewisse Ratlosigkeit, die einen bis heute befällt, wenn Israelsolidarität wirklich einmal praktisch werden soll: Man ist sich nicht mehr so sicher, ob das, was man da tut, tatsächlich etwas austrägt, oder nicht im Gegenteil die Konfliktlinien verwischt. Veranschaulichen lässt sich das Problem am Beispiel einer israelsolidarischen Kampagne, die die Gruppe [a:ka] im Herbst 2011 in Göttingen unter dem Titel „Keine Bühne gegen Israel“ gestartet hat. Es ging um den gescheiterten Versuch, das Konzert eines antizionistischen Musikers beim jährlichen Göttinger Jazzfestival zu verhindern.
Kampf gegen den jüdischen „Stammesaktivismus“
Zum besseren Verständnis muss vorab der Kontext erwähnt werden, in dem die Kampagne stattfand. Die Stadt Göttingen beherbergt lediglich zwei Kulturveranstaltungen, die der vorherrschenden provinziellen Ödnis ein wenig Glamour verleihen: Die Internationalen Händelfestspiele im Frühjahr und das – ebenfalls international renommierte – Jazzfestival im Herbst. Beide Veranstaltungen werden von der Stadt unterstützt und zu einem erheblichen Anteil aus öffentlichen Mitteln finanziert. Dem Jazzfestival kommt damit eine kaum zu überschätzende Bedeutung für das fadenscheinige Image Göttingens als Kulturhochburg zu – was erklären mag, weshalb die Kritik des [a:ka] an einem einzigen von über hundert beim Festival auftretenden Musikern in bundesweiten Medien zum Politikum werden konnte und bei den Verantwortlichen zu Panikreaktionen führte.
Es ging um den Multi-Instrumentalisten Gilad Atzmon, der zu einem der Hauptkonzerte auf großer Bühne eingeladen worden war. Atzmon ist israelischer Staatsbürger, lebt aber in London und nimmt für sich in Anspruch, Exilant zu sein. Als Musiker genießt er über die Jazz-Szene hinaus einen guten Ruf. Bekannt wurde er in den vergangenen Jahren jedoch nicht als Musiker, sondern als antizionistischer Reisekader, als bekennender Achmadinedschad-Versteher, kurz: als jüdischer Kronzeuge der antisemitischen Internationale. Seine Band hat er nach dem ehemaligen Hauptquartier der PLO das „Orient-House-Ensemble“ benannt, und sein politisches Ziel ist entsprechend die Auflösung Israels samt der Auslieferung der dann rechtlos gewordenen Israelis an die Gnade der Araber – was er, wenn er sich unter Gleichgesinnten wähnt, auch beinahe wörtlich so formuliert. (1) In der Öffentlichkeit redet er lieber von einer gerechten Ein-Staaten-Lösung, was bekanntlich aufs Gleiche hinausläuft, aber nobler klingt.
Natürlich pflegt Atzmon auch die sattsam bekannte Gleichsetzung des Zionismus mit dem Nationalsozialismus: „Für mich ist der Zionismus als rassistisch-expansionistische Bewegung nicht von der Nazi-Ideologie zu unterscheiden.“ (2) Wenn er dann doch einen Unterschied findet, fällt der zu Ungunsten Israels aus: „Ich glaube, dass Israel aus einer bestimmten ideologischen Perspektive noch schlimmer ist als Nazi-Deutschland, denn anders als Nazi-Deutschland ist Israel eine Demokratie. Und das bedeutet, das Israels Bürger Komplizen der israelischen Greueltaten sind.“ (3) Ein offenes Bekenntnis zum Judenhass wird man von Atzmon nirgendwo zu lesen bekommen, doch selten findet man den inneren Zusammenhang von Antisemitismus und Antizionismus so knapp auf den Punkt gebracht wie in seinen Texten: „Zionismus (als Ideologie), Judaismus (als Religion), Jüdischkeit (als Identität) und die Juden (als Volk) sind eng miteinander verknüpft […] die jüdischen Lobbys, jüdische Pressure-Groups und jede andere Form des jüdischen Stammesaktivismus (sind) nicht voneinander zu unterscheiden.“ (4)
Da er den Juden unverblümt eine weltumspannende Verschwörung im Dienste des Zionismus vorwirft und dennoch kein Antisemit sein will, muss er seine Herkunft zum Alibi machen: Er ist ein Jude, der gegen die vermeintliche Verschwörung kämpft; also muss er den Juden die Freiheit zugestehen, dem „Stammesaktivismus“ den Rücken zu kehren, weshalb er unmöglich Antisemit sein kann – quod erat demonstrandum. Natürlich ist diese Rabulistik so leicht zu durchschauen wie eine frischgeputzte Fensterscheibe, aber sie erfüllt ihren Zweck: Atzmon bedient jedes antisemitische Klischee seiner Anhänger, doch seine Gegner können ihn nicht darauf festnageln, weil er das Gegenteil immer gleich mitbehauptet. Den Holocaust nennt er eine „neue Religion“ im Dienste von Zionismus und Imperialismus. Er „diente dazu, die Aufmerksamkeit von den ungeheuren Verbrechen der Alliierten abzulenken. Hiroshima, Nagasaki und Dresden sind nur die Kürzel für den institutionalisierten Völkermord aus der Hand des englischsprachigen Imperiums.“ (5) Folgerichtig fordert er unter Bezugnahme auf Achmadinedschad, dass „dieses historische Kapitel historisch untersucht werden muss“ (6) – wirft man ihm daraufhin jedoch vor, die Judenvernichtung zu leugnen, schäumt er vor Empörung und verweist auf die vielen Auschwitz-Überlebenden, die er in seiner Kindheit als Nachbarn hatte.
Und schließlich wendet er ein zentrales Motiv des modernen Antisemitismus diametral in die Gegenrichtung, ohne dass der diese Volte erklären könnte. Seit dem 19. Jahrhundert appelliert der Antisemitismus an diffuse Ressentiments gegen Fortschritt und Aufklärung, und zehrt von der Sehnsucht nach dem „ursprünglichen“ Leben in einer romantisch verklärten Vergangenheit. Bei Atzmon dagegen hat die zionistische Weltverschwörung die Rückkehr in die finstere Unmündigkeit der Vormoderne zum Ziel und den Antizionisten fällt die Rolle der Verteidiger von Humanismus, Fortschritt und Menschenrechten zu. Die Rettung der Aufklärung hängt für ihn also am Sieg von Muslimbrüdern, Salafisten, Baathisten, Alt-Stalinisten und Mullahs über die einzige Gesellschaft des Nahen Ostens, die über eine demokratische Regierung, funktionierende Universitäten, ein liberales Familienrecht und eine nicht von Mord bedrohte Schwulenszene verfügt. Ob er diese Thesen tatsächlich glaubt, oder sie zur Tarnung einsetzt, um Kritiker zu besänftigen, ist schwer zu beurteilen – vermutlich dienen sie ihm nicht zuletzt dazu, sich selbst über die Motive und die möglichen Folgen seines Hasses zu betrügen. Festzuhalten für den Verlauf der Kampagne gegen Atzmons Auftritt in Göttingen ist jedenfalls, dass man dieses Maskenspiel auch als Angebot zur kollektiven Selbsttäuschung verstehen kann: Wer nicht so genau wissen will, wer da eigentlich auf der Bühne steht, kann ihn sich als glühenden Verteidiger westlicher Werte oder als mitfühlendes, unter Auschwitz-Opfern aufgewachsenes Kind imaginieren. Geradezu prototypisch macht Atzmon vor, was den Antizionismus als Antisemitismus im Stande seiner Ächtung so attraktiv macht – seine Anhänger können ihre Ressentiments gegen die Juden pflegen und gleichzeitig daran glauben, sie hätten gar keine.
Ein Konzert im Rahmen der fdGo
Bevor es sich für eine öffentliche Kampagne entschied, hatte das [a:ka] noch versucht, mit einer nicht-öffentlichen Mail an die Veranstalter eine Absage des Konzertes zu erreichen – vielleicht hatte man ihn ja aus Unkenntnis eingeladen, so die naive Hoffnung. Die zerschlug sich schnell, denn die Argumente des [a:ka] wurden unter anderem mit dem Hinweis zurückgewiesen, Atzmon sei ein hochpolitischer und engagierter Mensch. Erst als sich das [a:ka] mit der Jüdischen Kultusgemeinde (7) zusammentat, und diese ihre Verbindungen zum Kulturamt der Stadt spielen ließ, brach bei den Verantwortlichen Panik aus. Noch bevor irgend die Kritik am Atzmon-Auftritt an die Öffentlichkeit gelangt war, zog die Stadt den Kulturamtsleiter aus dem Vorstand aus dem Jazzfestival-Trägerverein zurück. Die Verwaltung berief ein Krisentreffen ein, an dem neben ihr und der Kultusgemeinde auch die Festivalleitung und das [a:ka] teilnahmen. Nach einem überaus unerfreulichen Gesprächsverlauf fasste das [a:ka] einige Atzmon-Zitate zu einem Boykottaufruf zusammen, von dem es hoffte, dass er auch die universitäre Durchschnitts-Linke und die linksliberale Vollkorn-Bourgeoisie des Göttinger Ostviertels schockieren würde. Man hoffte dieses Spektrum zu erreichen, indem man sie bei ihren eigenen Widersprüchen packte: „Auch an diesem 9. November wird das Göttinger Establishment am Platz der Synagoge der von Nazis ermordeten Juden gedenken – und drei Tage später dann auf Einladung des Jazzfestivals einen Mann bejubeln, der nicht nur die Mörder der einstigen Juden für Opfer eines alliierten Kriegsverbrechens hält, sondern das Gros der heutigen Juden für Komplizen einer zionistischen Weltverschwörung. So wahnwitzig diese Vorstellung ist, so real ist die Komplizenschaft, in die sich das Göttinger Jazzfestival begeben hat. Sie weiß, wofür Gilad Atzmon steht, sie hat ihn nicht aus Unkenntnis eingeladen – es ist ihr zumindest gleichgültig, einem Hetzer gegen Israel den roten Teppich auszurollen.“ (8)
Der Aufruf erschien zunächst im Internet, ging über diverse Mailinglisten und lag an einschlägigen Orten aus. Am 9. November und im Umfeld des Jazzfestivals sollte er verteilt werden, doch das war gar nicht mehr notwendig – zuvor hatte bereits die Festivalleitung selbst für stadtweite Bekanntheit des Boykott-Aufrufs gesorgt, indem sie sich mit einer Pressemitteilung an die Medien wandte: Man könne ja verstehen, dass Atzmons Haltung „angesichts der deutschen Vergangenheit“ irritiere und verletze, doch handele es sich bei ihm um einen Künstler, der „humanistischen, antirassistischen und demokratischen Werten“ verpflichtet sei. Man werde keine „politische Zensur ausüben, solange die Aussagen des Künstlers nicht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen“. (9) Die Veranstalter entblödeten sich nicht, auch noch darauf hinzuweisen, sie hätten 1988 mit Coco Schumann auch einmal einen Auschwitz-Überlebenden im Programm gehabt.
Angehängt an die Pressemitteilung war eine Stellungnahme Atzmons, in der er sämtliche von uns angeführten Zitate als Fälschungen bezeichnete. Er wirft darin mit Begriffen wie „humanistisch“, „universalistisch“ und „antirassistisch“ um sich, faselt von seiner „moralischen Pflicht“ und fragt: „Werde ich zum Nazi, wenn ich darauf bestehe, dass Geschichte (Geschichtsschreibung) offen und frei diskutiert werden muss?“ Zum Schluss klebt er gleich zwei antizionistische Topoi in einem Satz zusammen – den Die-Juden-haben-aus-Auschwitz-nichts-gelernt-Topos und den Ich-bin-ein-Opfer-zionistischer-Propaganda-Topos: „Ich wollte immer daran glauben, dass Juden, die auf ihrem Weg durch die Geschichte soviel erleiden mussten, die ersten sein würden, die sich gegen Rassismus und Unterdrückung wehren. Wie enttäuschend ist es daher, herauszufinden, dass im heutigen Weltgeschehen der jüdische Staat die einzige [!] Besatzungsmacht darstellt, und dass seine Unterstützer hier in Göttingen gegen das elementare Recht der Meinungsfreiheit vorgehen.“ (10)
Aus PR-Gesichtspunkten waren diese Stellungnahmen für die Verfasser zunächst ein Desaster, denn sie weckten die Aufmerksamkeit der Medien und verschafften den Atzmon-Kritikern eine Öffentlichkeit, die sie aus eigener Kraft nie erreicht hätten. Am 4. November meldete das Göttinger Tageblatt auf der Titelseite den Rückzug des Kulturamtsleiters aus der Festivalleitung. (11) Im Feuilleton brachte das Blatt einen ausführlichen Bericht über den Konflikt, in dem – trotz erkennbarer Sympathien für das Jazzfest – auch die Position der Kritiker ausführlich referiert wurde. (12) Damit standen ein internationales Musikfestival und ein kommunaler Spitzenbeamter in direktem Zusammenhang mit einem Antisemitismus-Streit und der Vorgang hatte die Schwelle zum Skandal überschritten. In den folgenden Tagen berichteten weitere Zeitungen wie die Hessisch-Niedersächsische Allgemeine, die Taz und die Junge Welt; überregionale und sogar bundesweite Radiosender wie NDR-Info, NDR-Kultur oder der Deutschlandfunk schlossen sich an.
Diese Welle öffentlicher Aufmerksamkeit rollte derart heftig über das Jazzfestival hinweg, dass das [a:ka] fast schon auf eine Absage des Konzertes hoffte; zumindest wähnte man sich eines gewissen Grades von Zustimmung sicher. Das [a:ka] schrieb Pressemitteilungen und gab Interviews und glaubte Atzmons Glaubwürdigkeit erschüttern zu können, indem es jedes einzelne seiner von ihm selbst bestrittenen Zitate belegte. Und plötzlich hatte der Boykott-Aufruf Unterstützer, mit denen niemand gerechnet hätte – innerhalb weniger Tage ließen sich eine Antifa-Gruppe, eine Antisemitismus-AG und ein Landtagsabgeordneter der Linkspartei (!) unter das Flugblatt setzen. Selbst das Deutsche Theater (DT), bis dato stolzer Gastgeber des Jazzfestivals, legte wert auf die Feststellung, dass es nur Vermieter sei und auf die Programmgestaltung keinerlei Einfluss habe. Dann jedoch reichte ein einziges Interview, um die Stimmung in ihr Gegenteil zu verkehren.
Ein Freispruch erster Klasse
Der Frankfurter Publizist Micha Brumlik gilt unter Feuilletonisten als moralische Instanz in Sachen Antisemitismus – soll heißen, er ist ein Vorzeige-Intellektueller, dessen Expertenwort auch dann gefragt ist, wenn er kaum eine Ahnung hat, worum es eigentlich geht. Eine Woche vor dem Konzert wurde Brumlik von NDR-Info zum Göttinger Atzmon-Streit befragt und verkündete in der Magazinsendung Schabbat Shalom folgendes Urteil: Atzmon sei kein Holocaust-Leugner (was niemand behauptet hatte), die Zitate seien aus dem Zusammenhang gerissen (was nur insoweit richtig ist, als ein Zitat ohne den Zusammenhang, aus dem es stammt, keines wäre) und das eigentliche Motiv der Kritiker sei die Abwehr deutscher Schuld: „Wenn es heute nicht-jüdische Deutsche, nicht-israelische Kräfte gibt, die im Brustton der Selbstgerechtigkeit so etwas wie einen abstrakt-universalistischen Anti-Antisemitismus aufrufen, und dabei nur allzu gerne bereit sind, auch Juden des Antisemitismus zu zeihen, dann weist das nur auf eine weitere Flucht vor der deutschen Verantwortung, vor der Geschichte hin.“ (13)
Damit hatten die Kritiker ausgespielt: Alles, was zum Thema Atzmon jetzt noch erschien, zitierte bzw. kolportierte Brumlik, und aus ernstzunehmenden Kritikern waren über Nacht durchgeknallte Radikalinskis mit Geschichts-Dachschaden geworden. Ganz vorbei war es, als sich auch noch die Jüdische Gemeinde, die liberale Konkurrenz der Jüdischen Kultusgemeinde (14), einmischte und Atzmon in schwer zu übertreffender Naivität ein Gespräch anbot. Unmittelbar vor dem Konzert traten Atzmon und einige Gemeindevertreter einträchtig vor die Presse und lobten, obgleich man sich nicht einig geworden sei, das angenehme und konstruktive Gesprächsklima. Das NDR-Fernsehteam, das ursprünglich über die angekündigten Proteste berichten wollte, begnügte sich daraufhin mit O-Tönen und O-Bildern Atzmons und der Gemeinde; von der Kundgebung wurde noch nicht einmal ein Bild eingeblendet. Die Zeitungen schrieben am Ende nur noch über das berührende Konzert eines großen Musikers. In der Vorhalle des Theatersaals hatte ein Jazzfreund sein eigenes Flugblatt ausgelegt, in dem er das Ergebnis von zwei Wochen öffentlicher Debatte bündig zusammenfasst: „Gilad Atzmons Musik spricht für sich selbst. Sie führt selbsthörend die gegen ihn erhobenen Vorwürfe ad absurdum. Die tiefe Humanität, die Offenheit, mit denen er die verschiedenen Stilistiken aus den unterschiedlichsten kulturellen Quellen […] in seine musikalische und damit auch humane Vision integriert, machen jeden vordergründig anti-israelischen Vorwurf lächerlich.“ (15) Will sagen: Wer Jazz mit orientalischer Folklore aufmotzt, kann kein schlechter Mensch sein. Gegen diesen Common Sense gab es kein Durchkommen mehr – wem Eklektizismus plus Ethnokitsch als künstlerischer Beweis einer humanen Gesinnung durchgeht, dem gilt Kulturrelativismus plus „Israelkritik“ als höchstes Stadium der Aufklärung.
Zwischen Staatsräson und Ressentiment
Zweierlei konnte man am Verlauf der Kampagne wunderbar beobachten. Erstens: Kaum ein Thema taugt in Deutschland heutzutage so gut, um einen Skandal zu provozieren, wie der Antisemitismus. Das ist bekannt. Und zweitens: Zur Bekämpfung des Antisemitismus trägt seine Skandalisierung nicht das Geringste bei. Statt die Veranstalter zur Absage des Konzertes zu zwingen oder wenigstens das Publikum zu einem Boykott zu bewegen, glänzten zuletzt Kulturverwalter, die sich als Verteidiger der Meinungsfreiheit gegen extremistische Fanatiker präsentieren durften, und Atzmon bekam sein Publikum, das nicht nur wegen der Musik angetreten war, sondern auch, um ein politisches Statement abzugeben und dabei den Kitzel des vermeintlichen Tabubruchs zu spüren. Nicht wenige Altlinke, denen das Jazzfestival eigentlich viel zu teuer und abgehoben ist, hatten sich Karten besorgt, die Palitücher frisch gewaschen und schritten mit trotziger Miene an den Teilnehmern der Protestkundgebung vorbei.
Im deutschen Vergangenheitsbewältigungsdiskurs darf niemand so ohne weiteres öffentlich gegen Israel auftreten. Zur berüchtigten besonderen Rolle Deutschlands nach Auschwitz gehört es, sich pflichtschuldig zum Staat der Juden zu bekennen. Angela Merkel fasste das vor der Knesset kongenial in die Worte, die Sicherheit Israels sei Teil der deutschen Staatsräson. Damit allerdings hat sie mehr ausgeplaudert als sie vermutlich wollte, denn diese Staatsräson ist in sich höchst widersprüchlich. Es geht, wenn Israel aus deutscher Perspektive betrachtet wird, eigentlich nicht um Israel, sondern immer um Deutschland – es geht darum, sich der „Lehren aus der Geschichte“, die man gezogen habe, zu vergewissern. Bei jenem Israel, von dem in diesem Zusammenhang die Rede ist, handelt es sich nicht um den realen Staat der Juden, der sich im Nahen Osten seiner feindlichen Nachbarn zu erwehren hat, sondern um ein Phantasma, das einzig in den Köpfen der Deutschen existiert. Dort kommt ihm eine doppelte Funktion zu: Sich als Nachkommen der Täter mit den Opfern von einst zu identifizieren und sich moralisch über sie zu erheben – weil man selbst aus der Vergangenheit gelernt habe, dass Gewalt und Krieg der falsche Weg sei, während die Israelis an diesem falschen Weg festhielten.
So betrachtet ist Staatsräson für Israel Teil jener neuen deutschen Ideologie, unter der sich Deutschland nicht trotz, sondern wegen Auschwitz zur moralischen Weltmacht erhebt; ganz wie das Holocaust-Mahnmal im Zentrum Berlins, wie die „Stolpersteine“ vor den Wohnhäusern und Arbeitsstätten ermordeter Juden oder wie die obligatorischen Mahnwachen zum 9. November in sämtlichen größeren Städten. Andererseits drückt sich im Begriff der Staatsräson immer auch eine Zumutung aus – etwas, dem man sich in Anerkennung höherer Zwecke zu fügen hat, ob man es einsieht oder nicht. Dem zu widersprechen, nährt die rebellische Aura des Antisemitismus. Nie war es einfacher, nie war es moralisch weniger verfänglich, seinem antisemitischen und antizionistischen Ressentiment Ausdruck zu verleihen als unter dem Walten dieser Staatsräson: Man muss keine Brunnenvergifter und keine Kindermörder mehr bemühen, es reicht schon, trotzig auf seinem Recht auf Israelkritik zu beharren, und man darf sich als Rebell fühlen. Darin bestand übrigens auch der antisemitische Gehalt der jüngsten Grass-Debatte – seine Gesinnungsgenossen in der Leserschaft der Süddeutschen Zeitung brauchten ihm nur im Stillen recht zu geben, und sie konnten an einem tagelangen Schlagzeilengewitter partizipieren, das ihnen die Befriedigung verschaffte, eine vermeintlich verbotene Wahrheit gedacht zu haben.
Veranstalter wie Besucher eines Jazzfestivals gehören gemeinhin zu jener Sorte Deutscher, die stolz darauf sind, aus der Vergangenheit gelernt zu haben. Wirft man ihnen das Wort Auschwitz hin, antworten sie, wie aus der Pistole geschossen: „Singuläres Menschenheitsverbrechen“. Und doch hätte das Göttinger [a:ka] ganze Aktenordner voller antisemitischer Atzmon-Zitate vorlegen können, ohne an ihrer Unterstützung für diesen Mann irgendetwas zu ändern. Von der Staatsräson, der man sich zu unterwerfen hat, an die man selbst in gewissem Maße sogar glaubt, sieht man Atzmon, als Juden, befreit. Indem man seinen Wahn als Ausdruck von Meinungsfreiheit verteidigt, partizipiert man, gleich den liberalen Freunden des Herrn Grass, an einem Tabubruch, den man sich selbst niemals öffentlich gestatten würde. Ob antizionistische Hetze öffentlich tolerabel oder gar zustimmungswürdig ist, hängt in Deutschland immer davon ab, wer sie äußert. In einschlägigen Internetforen beklagen sich Neonazis, dass sie für Atzmons Thesen wegen Volksverhetzung verklagt worden wären, während man „dem Juden“ so etwas durchgehen lasse. Und ganz falsch liegen die Kameraden mit dieser Einschätzung nicht. Auch Micha Brumlik zeigt sich für dieses Sprechort-Problem anfällig – jedenfalls hatte er keinerlei Probleme, bei Günther Grass, dem ehemaligen SS-Mann, eben jenen Antisemitismus zu finden, von dem er bei Atzmon, dessen Äußerungen viel krasser sind, nichts wissen wollte. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte er: „Zu den wenigen harten Kriterien für antisemitische Äußerungen zählt die Dämonisierung von jüdischen Personen oder Institutionen. Israel ist ohne Zweifel ein jüdischer Staat. Und in diesem Gedicht wird dem Staat Israel vorgehalten, möglicherweise das iranische Volk auslöschen zu können und zu wollen. Das hat jedoch mit keiner politischen Wirklichkeit auch nur das Allergeringste zu tun. Deshalb sehe ich dies als einen typischen Ausdruck von Dämonisierung und damit als Antisemitismus an.“ (16)
Der Verweis auf die Meinungsfreiheit ist außerdem ein Mittel, sich selbst gegen öffentliche Kritik zu immunisieren: Die Adressaten müssen sich mit ihrem Gehalt nicht länger auseinandersetzen. Das bessere Argument, selbst der Beweis, zählen nichts gegen eine Meinung, auf der man beharren darf wie auf seinem Eigentum. Adorno hat diese Funktion der Meinung deshalb auch als Panzerung gegen die Reflexion beschrieben: „Über das, was wahr und was bloße Meinung, nämlich Zufall und Willkür sein soll, entscheidet nicht, wie die Ideologie es will, die Evidenz, sondern die gesellschaftliche Macht, die das als bloße Willkür denunziert, was mit ihrer eigenen Willkür nicht zusammenstimmt.“ (17) Dieser Mechanismus funktioniert auch dann, wenn das Ergebnis offen paradox ausfällt, wie in der Argumentation der Atzmon-Verteidiger: Wenn Gilad Atzmon sage, Israel sei schlimmer als die Nazis, dann sei das seine Meinung, und sein Recht, sie auszusprechen, gelte es aus demokratischen Gründen zu verteidigen. Wenn seine Kritiker dagegen anhand von Zitaten nachweisen, dass für Atzmon Israel schlimmer ist als die Nazis es waren, dann sei das nur deren Meinung, sprich eine überspitzte und verzerrte Sichtweise, die keinen Anspruch auf Wahrheit erheben könne.
Das bessere Argument gleitet ab an dem Panzer, den die Antizionisten zum Schutze ihres Ressentiments vor dem Gedanken errichtet haben. Nicht einmal der Schockeffekt, den die öffentlich präsentierte Sammlung von Atzmon-Zitaten auslösen sollte, konnte verfangen – falls er irgendwo eintrat, wurde er schnell wieder verdrängt. Deshalb hat Micha Brumlik das Scheitern der Boykott-Kampagne auch nicht verursacht, sondern nur beschleunigt. Er brauchte die Festivalgäste ja nicht zu überzeugen; er hat ihnen nur Absolution erteilt und sie damit als jüdischer Kronzeuge auch ermächtigt, auszusprechen, dass ein engagierter Gegner der „israelischen Verbrechen“ jedem weltoffenen Jazzfestival gut zu Gesicht stehe, und dass Zionistenfreunde besser die Klappe halten sollten.
Die Kampagne gegen Atzmons Auftritt war also bestenfalls nutzlos. Möglicherweise war sie sogar schädlich, bot sie doch Antizionisten die Gelegenheit, ihre Gesinnung auszuleben. Dass beim Jazzfestival ein fanatischer Feind Israels spielt, wäre ohne die öffentlichen Proteste vermutlich kaum jemandem aufgefallen. Mit dem Versuch, Atzmons Auftritt zu ächten, wurde letztlich das Gegenteil bewirkt: Er hat die Anerkennung der Öffentlichkeit erhalten – nicht nur als Musiker, sondern auch als Antizionist.
Keine Praxisanleitung zum Schluss
Was bleibt übrig von einer Israelsolidarität, die nur als wohlfeiles Bekenntnis existiert, solange sie als politische Praxis nichts ausrichten kann? Wenn der Versuch des Göttinger [a:ka], mit Argumenten über den eigenen Kreis hinaus zu wirken, nicht an taktischen Fehlern gescheitert ist, sondern an der Übermacht ideologischer Denkformen in der Gesellschaft, dann ist es praktisch unmöglich, die Kluft zwischen kritischer Theorie und politischer Intervention zu überbrücken. Weil dem Antisemitismus eben kein rationaler Gedanke zugrunde liegt, stößt die Vernunft bei seiner Kritik auf eine „Grenze der Aufklärung“ (18), schreibt der Soziologe Detlev Claussen: Der „gutwillige Anti-Antisemit legt das rationalistische Grundmuster der Aufklärung an ein menschliches Verhalten an, das gerade nicht durch den reflexiven Gebrauch des Verstandes […] charakterisiert wird“ (19) – und agiert dabei, so kann man hinzufügen, gerade nicht als reflektierter Kritiker antisemitischer Verhältnisse, sondern als engagierter Gutmensch, der sich von moralischer Empörung leiten lässt statt von kritischer Erkenntnis. Das Ergebnis ist jenes Dilemma, in dem nicht nur die meisten Kritiker des Grass-Gedichtes gefangen blieben, sondern auch das [a:ka] bei seiner Kampagne gegen Gilad Atzmon: „Der öffentliche Diskurs, ob etwas antisemitisch sei oder nicht, ist selbst ein Teil der antisemitischen Praxis.“ (20) Und ein praktisches Rezept, wie dieser Diskurs zu sprengen wäre, wird unter den gegebenen Bedingungen schwerlich zu finden sein.
Die Frage bleibt, was aus dieser Erkenntnis zu schlussfolgern wäre. Zunächst einmal wäre das eigene Selbstverständnis bescheidener zu formulieren: Wenn sich der hehre Anspruch der „praktischen Israelsolidarität“ im Alltag nicht einlösen lässt, gerät er zur Phrase; wider besseres Wissen an ihm festzuhalten, wäre fast so vermessen wie das Attribut „revolutionär“ im Namen einer Kleinstadt-Antifa. Was aber bedeutet es für das eigene Programm, wenn der Praxis-Anspruch aus der Präambel gestrichen ist? Sollte man auf kritische Intervention künftig verzichten, um die Gefahr des Scheiterns zu vermeiden? Sollte Kritik also auf die abgeschlossenen Zirkel privater Lesekreise beschränkt werden, wo sich Erkenntnis pflegen lässt, während die Welt ausgesperrt bleibt? Das wohl kaum, denn Kritik, die sich der Auseinandersetzung zu entziehen versuchte, wäre keine Kritik mehr. Zwar findet sie im Medium des Denkens statt, aber Denken kann nur solange Kritik sein, wie es sich mit seinem Gegenstand konfrontiert; solange es also interveniert, sprich: dazwischengeht. In der Auseinandersetzung mit der Gesellschaft wird Kritik ihrerseits zu einer Form von Praxis; der einzigen Form, die unter den gegebenen Verhältnissen noch möglich scheint. Freilich darf man nicht erwarten, damit große Erfolge zu erzielen: Das ist ja gerade die Illusion, die den politischen Aktionismus notwendig zum Selbstbetrug verkommen lässt. Immer wieder macht man allerdings die Erfahrung, bei dem einen oder anderen doch noch etwas zu berühren, was ihn für die Kritik empfänglich macht. Auf diese Weise allein kann Kritik weitergegeben und auf der Höhe der Zeit entwickelt werden – in der Hoffnung, „daß der Bann der Gesellschaft einmal doch sich löse.“ (21) Und sei sie noch so gering.
Jan Singer (Bahamas 64 / 2012)
Anmerkungen:
- So etwa in einer Grußadresse auf der antiimperialistischen Palästinakonferenz im November 2010 in Stuttgart. Nachzuhören ist seine Rede unter www.youtube.com/watch?v=MlvaN2c-Oto (dieses und alle weiteren Internetverweise wurden am 11. Juni 2012 abgerufen).
- Gilad Atzmon in einem Statement zur Konferenz Marxism 2005 der englischen Socialist Workers Party. Zitiert nach www.bo-alternativ.de/macondo-leserbrief.htm.
- Gilad Atzmon: The Truth in Stuttgart, www.gilad.co.uk/writings/truth-in-stuttgart-1.html.
- Gilad Atzmon: Tractatus Logico Palestinicus, www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=6152&lg=de. Übrigens bleibt die Anspielung auf Wittgenstein nicht beimTitel stehen; auch der Aufbau des Textes ist an die logische Form der Wittgensteinschen Argumentation angelehnt, und er endet auch mit einem Zitat: „Alles was sich aussprechen lässt, lässt sich klar aussprechen; wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.“ Natürlich ist Wittgenstein gegen einen derartigen Missbrauch seiner Arbeit in Schutz zu nehmen – dass sich jemand wie Atzmon mit seiner Vorliebe für vermeintlich klare, widerspruchsfreie Tatsachen für den berühmten Schluss des Tractatus’ begeistern kann, ist andererseits auch wieder nicht allzu verwunderlich.
- Gilad Atzmon: Wer ist Jude?, www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=8923&lg=de.
- Ebd.
- Die Jüdische Kultusgemeinde für Göttingen und Südniedersachsen e.V. ist eine konservative, nicht-orthodoxe Gemeinde, die sich 2005 von der liberaleren Jüdischen Gemeinde Göttingen getrennt hat. Auch diese Gemeinde sollte in der Kampagne noch eine Rolle spielen. Mit dem [a:ka] und dem ihr nahestehenden Jüdischen Lehrhaus (www.juedisches-lehrhaus-goettingen.de/) bildet die Kultusgemeinde den Kern des Göttinger Israelbündnisses, das seit dem Libanon-Krieg 2006 anlassbezogen zusammentritt und zu israelsolidarischen Kundgebungen aufruft.
- [a:ka] Göttingen, Flugblatt Eine Bühne gegen Israel?, http://akagoettingen.blogsport.de/ 011/11/01/eine-buehne-gegen-israel-jazzfestival-laesst-ns-verharmloser-auftreten/.
- Presseerklärung des Jazzfestivals vom 11. November 2011, zitiert nach www.goest.de. Einzelne Artikel der in linken Göttinger Kreisen vielgelesenen Gutmenschen-Plattform goest.de sind leider nicht direkt zu verlinken, man findet sie aber problemlos über der Archivspalte. Für Interessierte empfiehlt es sich, die dortige „Berichterstattung“ zur Atzmon-Kampagne einmal komplett durchzulesen: Die stets kruden Texte der Seite kippen bei diesem Thema derart ins Wahnhafte, dass jeder Versuch einer satirischen Zuspitzung zwecklos wäre. Als Teaser hier die Verrenkungen der Redaktion, warum sie zwar sämtliche Antworten der Gegner veröffentlicht hatte, nicht jedoch die Kritik oder wenigstens die Atzmon-Zitate selbst: „In einer anonymen E-Mail an die goest-Redaktion, deren Absender sich als a:ka bezeichnet, betont der Schreiber / die Schreiberin, das Flugblatt mit Boykottaufruf gegen das Jazzfestival sei von der Gruppe a:ka . Ein Beleg dafür sei die Tatsache, dass dieses Flugblatt auf einer Webseite einsehbar sei, die sie ebenfalls als Seite des aka bezeichnet.“ Wohlgemerkt: Die Gruppe, ihre Mailadresse und ihre Internetseite sind der Redaktion seit Jahren bekannt – und doch hat sie diesen Stiefel eisern durchgezogen, wochenlang und immer wieder.
- Alle Zitate aus der Stellungnahme Gilad Atzmons auf das Flugblatt wurden zitiert nach www.goest.de
- Göttinger Tageblatt, 4.11.2011, S. 1
- Ebd., S. 15
- Exzerpt des Brumlik-Interviews vom 8. November 2011, zitiert nach www.goest.de
- vgl. Fußnote 7
- Jürgen Hartmann, Flugblatt vom 14. November 2011, zitiert nach www.goest.de
- Micha Brumlik in der Süddeutschen Zeitung vom 10. April 2012, zitiert nach www.sueddeutsche.de/kultur/micha-brumlik-zum-guenter-grass-grass-ist-kein-antisemit-bedient-sich-aber-antisemitischer-deutungsmuster-1.1328656
- Theodor W. Adorno: Meinung Wahn Gesellschaft, in ders.: Kulturkritik und Gesellschaft II, Frankfurt a. M. 1997, S. 578
- Vgl. Detlev Claussen: Die Wandlungen des Ja-aber-Antisemitismus – Vorbemerkungen zur Neuausgabe von 2005, in ders.: Grenzen der Aufklärung, überarbeitete Neuausgabe, Frankfurt 2005, S. IX
- Ebd., S. VIII
- Ebd.
- Theodor W. Adorno: Gesellschaft, in ders.: Soziologische Schriften I, Frankfurt a. M. 1997, S. 19
SPALTE3-AKTUELL-RUBRIK
Frühere Aktivitäten sind im Aktuell-Archiv aufgeführt. Dort gibt es auch einige Audio-Aufnahmen.
Alle bisher erschienenen Ausgaben der Bahamas finden Sie im Heft-Archiv jeweils mit Inhaltsverzeichnis, Editorial und drei online lesbaren Artikeln.