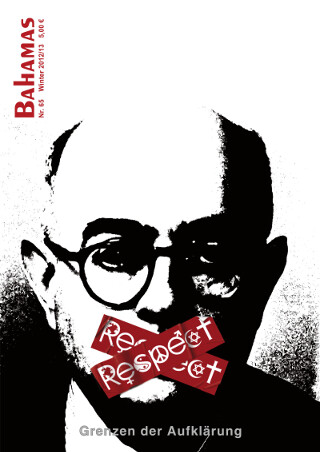Blindes Grätschen ist nicht mehr gefragt
Die DFB-Elf symbolisiert alerte Markttauglichkeit, nicht nationale Selbstbehauptung
Es gibt sie bei jedem Länderspiel seit jenem Weltmeisterschafts-Sommer 2006, für den sich die deutsche Fußballnationalmannschaft als „Projekt“, wie der seinerzeitige Trainer Klinsmann sie bezeichnete, neu erfunden hat: Jene peinlichen Momente, in denen die Vergangenheit die runderneuerte DFB-Elf und ihre liberalen, beredten und weltoffenen Architekten und Repräsentanten einholt. Dann leben längst überwunden geglaubte Sprechchöre wieder auf, aus Zeiten, in denen die Nationalmannschaft von einem Großteil ihrer Zuschauer als Wehrmachtsersatz in kurzen Hosen betrachtet wurde; typischerweise antwortete damals ein tiefer „Sieg“-Schrei auf einen dumpfen Trommelrhythmus oder man verlangte von sich und anderen: „Steh auf, wenn Du Deutscher bist!“.
Bei Länderspielen in München oder Frankfurt/M. dauern diese peinlichen Momente nicht allzu lange, nach zwei, drei Wiederholungen ebbt das Ganze wieder ab; nicht nur der TV-Reporter übergeht diese unliebsamen Bekundungen mit demonstrativem Schweigen, auch die große Mehrheit bleibt der alten Stimmungsmache gegenüber betont passiv, ja zischt sogar ablehnend. Je weiter es allerdings nach Osten geht, desto weniger gelten auch die neuen, guten Länderspielmanieren: die alt-deutschnationale Anfeuerung durch größtenteils ostdeutsche Anhänger während der diesjährigen EM in Polen und der Ukraine muss dem smarten Trainer Joachim Löw (wohnhaft in Freiburg) und seinem Team ein unangenehmes Déjà-vu gewesen sein.
Doch für mehr als ein bisschen Peinlichkeit reicht es auch dort nicht mehr. In der heutigen Länderspiel-Fußballwelt, wo vor fast jedem Match die Mannschaftskapitäne über das Stadionmikrophon antirassistische Gelöbnisse ablegen, sind Szenen wie die 1996 in Zabrze unvorstellbar: Während eines Länderspiels gegen Polen entrollte der DFB-Anhänger-Mob ein Transparent mit der Aufschrift „Schindler-Juden, wir grüßen Euch“. Unvorstellbar zum einen, weil die meisten der damals Beteiligten heute bei solchen Anlässen Ausreiseverbot bekommen, zum Anderen aber vor allem, weil sie sich nicht mehr von der heutigen Nationalelf vertreten fühlen; sie merken genau, dass der neue Multikulturalismus für den alten Mono-Nationalismus keinen Platz mehr hat und fühlen sich entsprechend verraten und verkohlt.
Denn mittlerweile will Schwarz-Rot-Gold von Schwarz-Weiß-Rot abrücken, so weit es nur irgend geht. Die Frage, wer Deutscher ist, die Frage, die das „Steh auf...“-Gegröle ja aufwirft, beantwortet der Verband deshalb auch ganz anders als sein nicht zufällig 2006 endgültig geschasster Präsident Meyer-Vorfelder, der vor dem Nordostdeutschen Fußballverband 2001 noch als Grund für die damalige sportliche Talfahrt der Nationalelf über zu wenige „Germanen“ (Tagesspiegel, 8.1.2002) im deutschen Profifußball geklagt hatte. Statt auf rassische Selbstbesinnung, wie es Meyer-Vorfelder und Konsorten vorschwebte, setzte der DFB auf „kulturelle Vielfalt“ – und das nicht nur notgedrungen fußballtaktisch durch die verspätete Übernahme (in Wahrheit die Hauptursache für die Krise der Nationalelf im Jahrzehnt vor dem „Sommermärchen 2006“) der Defensiv-Viererkette englisch-italienischen Ursprungs und der damit verbundenen Aufweichung der bislang auf dem Spielfeld herrschenden Funktionshierarchien (Manndecker, Spielmacher etc.).
Und nicht nur die Strategie der Nationalelf änderte sich; die in den weißen Trikots mit dem Adlerwappen steckten, waren plötzlich auch ganz andere, entweder zivilisierte Jungangestellte mit Abitur oder soziale Aufsteiger mit unleugbarem „Migrationshintergrund“. Die diese Veränderung begleitende und orchestrierende mediale Präsentation vollzog gar eine glatte Kehrtwende: Noch zur WM 1990 in Italien veröffentlichte die Nationalmannschaft nach alter Tradition einen schmissigen Marschschlager mit Udo Jürgens, der – vermutlich unbeabsichtigt, aber umso verräterischer – musikalisch wie textlich die Erinnerung an den Einmarsch 1943 wachrief: „Wir sind schon auf dem Brenner, wir brennen schon darauf“ hieß es da im Refrain. Hingegen 2006 sang statt der Kicker mit Schlagerpaten das Ökodeutschland-Idol Herbert Grönemeyer zusammen mit dem Sangesduo Amadou & Mariam aus Mali einen WM-Song, bei dem nichts mehr an die Musikkorps von Polizei und Bundeswehr erinnerte, viel aber ans fortschrittliche Anti-Apartheid-Geschunkel einer Miriam Makeba; und deutlicher als der Titel „Zeit, dass sich was dreht“ sagt, hätte der Appell, den „Aufstand der Anständigen“ (Gerhard Schröder) auch im Umfeld der Nationalmannschaft zum Sieg zu führen, kaum ausfallen können
Eine Gemeinschaft kultureller Gemeinschaften
Dass Deutschland ideologisch sogar seinen Fußball auf Postnationalismus umgerüstet hat, ist bei den Antinationalen und Patriotismuskritischen noch nicht recht angekommen: Die wollen, wie die Grüne Jugend beispielsweise, noch mit ihrer Anti-Auto-Fähnchen-Kampagne das „Konzept des Nationalstaats überwinden“ (Frankfurter Rundschau 19.6.2012), während DFB und Sportpolitik längst weiter sind und, ganz im poststrukturalistischen Geist, die inhaltliche Neubesetzung von Schwarz-Rot-Gold betreiben. Insofern gingen während der EM kursierende antipatriotische Aufrufe fehl, die beklagten, dass die Bundesfarben „eine nationale Gemeinschaft konstruieren helfen, die andere ausschließt“; es ist ganz anders: Deutschland präsentiert sich als Gemeinschaft kultureller Gemeinschaften statt als nationaler Monolith.
Das Abscheuliche bei den entsprechenden Medien-Kampagnen der Sportpolitik liegt eher darin, dass die einstmals als fremd Wahrgenommenen nicht einfach als Kicker und damit als Individuen auftreten, sondern eben als Botschafter von Kulturen, als Vehikel kollektiver Wesensarten, die dem antirassistischen Identitätszwang unentrinnbar unterliegen. Ein schlagendes Beispiel gibt dafür der im TV allgegenwärtige Werbe-Jingle des DFB, der sinnigerweise mit „màs integración: dfb“ einen spanischen und eben keinen deutschen Slogan verbreitet: Er zeigt eine Gartenparty anlässlich eines Länderspiels, zu der auf einem gepflegten Mittelstands-Bungalow-Grundstück auch allerlei exotische Gäste kommen, eine dickliche, afrikanische Mutti, natürlich zünftig in bunte Tücher gehüllt, ebenso wie die unvermeidliche Kopftuchträgerin, die Şiş Kebap als Zugabe zu dem von den deutschen Gastgebern vorbereiteten Kartoffelsalat mitbringt; die Exoten erweisen sich im Verlauf dann als die vermeintlichen Eltern deutscher Nationalspieler, also als fiktive Mama und Papa Boateng, Özil oder Khedira; letztlich so, wie der Deutsche seine Ausländer, die er jetzt Mitbürger zu nennen gelernt hat, schätzt: als Importeur von fremdländischen Klängen und gewürzten Speisen – und neuerdings eben auch von anderen willkommenen Mitbringseln wie Spielverständnis und Kombinationstempo.
Wenn sich hier jemand ausgeschlossen fühlen soll, sind es eben die, die sich mit „Steh auf, wenn Du Deutscher bist“-Gegröle nicht mehr in Szene setzen können. Für den Manager der Nationalelf, Oliver Bierhoff, als Spieler selber schon der Prototyp des Schwiegermutter-Lieblings mit Abitur und BWL-Fernstudium, steht das sogar im Zentrum seines Wirkens. So zitiert eine Feuilleton-Redakteurin der Welt den Manager nach einem Tischgespräch: „Bierhoff sieht in der von ihm und Löw geformten Mannschaft eine Miniatur der neuen, deutschen Gesellschaft: ‚Unser Land ist freier geworden, moderner, man zeigt die Flagge und findet es schön, ohne in die rechte Ecke gestellt zu werden. All das haben wir mit viel Aufwand geschafft’.“ (20.10.2012)
Und so wurde bereits 2006 ein WM-Spiel-Planer der NPD beschlagnahmt und verboten, der den Slogan trug: „Weiß – nicht nur eine Trikotfarbe“, während ein weiterer, ebenfalls inkriminierter Planer ein Piktogramm enthielt, das unter dem Titel „Nationalelf 2010?“ zehn farbige und nur einen hellhäutigen Spieler zeigt. Wie tief der Stachel der Enttäuschung bei ihren früheren Fans sitzt, darüber, dass die Nationalelf nicht mehr „unsere“ ist, zeigt mehr als alles andere ein Blick in die Blogszene, wo sich Poster wie beispielsweise newbarbarian über die neuen Zeiten auskotzen: „Ich habe die deutsche Fußballnationalmannschaft geliebt. Ich war ein Hardcorefan. Jahrzehntelang stellte die DFB-Auswahl für mich das wichtigste deutsche Verfassungsorgan dar. Die Mannschaft war in dunklen Zeiten die einzige Projektionsfläche nationaler Identifikation. Sie war meist nicht schön, nicht sexy. Aber sie war unsere […] Der Nationalfußball war der Stinkefinger, den wir diesen ganzen missgünstigen Dreckbären [gemeint sind hier die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, U.K.] in den Arsch rammten. ‚Who won the war?‘ Klar, ihr. Aber wir wischen Wembley mit euch auf und wo seid ihr, wenn wir in Europa- und Weltmeisterschafts-Finals stehen?“ Heute hingegen sei alles anders und verkommen: „Mich macht das Selbstverständnis schaudern, mit dem sich der deutsche Nationalfußball präsentiert […], getragen von einem Verband, der vor Jahren noch ein fröhlicher Rückzugspunkt für echtdeutsches Gedankentum war“, und trainiert von einem „Übungsleiter, der […] mit seiner unecht gestylten Person stets den Eindruck eines dauerbeleidigten, untervögelten Weibes heraufbeschwört.“ (1)
Das Ende des „german tank“
Die multikulturell vermarktete Nationalelf ist also nicht länger das symbolische Ventil für das aggressive Beleidigtsein der real oder eingebildet Deklassierten, die hier ihre Zugehörigkeit zum Kollektiv beweisen durften und auch ihre nationale Zuverlässigkeit. Denn Auftritte, wie der eingangs geschilderte in Zabrze, befriedigten nicht nur die antisozialen Gelüste dieser Klientel, sondern ließen sie sich auch inszenieren als potentielle Reservearmee eines faschistischen Umsturzes: eine Selbsterhöhung als SA und SS im Wartestand, der niemand sich zu sagen traute, dass sie bis auf Weiteres nicht gebraucht würde. Klar auch, dass sich diese Bedürfnisse eher an unangenehm autoritäre Spielertypen hefteten, an echte Führer, pardon: Führungsspieler vom Schlage eines Sammer, Effenberg, Matthäus oder gar Jancker, die genau das verkörperten, was die englische Sportpresse mit dem Begriff „german tanks“ oder die italienische als „i panzer“ umschrieb. Deren Zeiten sind, allerspätestens seit 2010, nach dem unrühmlichen Abgang Michael Ballacks, des langjährigen Mannschaftskapitäns mit Geburtsort Görlitz, dankenswerterweise passé.
Der Ersatz für diesen schnauzenden Feldwebel-Typus ist allerdings nicht der eher widerborstige, mündige Spieler, wie er im Holland der 1970er Jahre ins Auge gefasst wurde. Vielmehr spiegelt die neue Spielergeneration unbedingte Anpassung an die Erfordernisse der genauso neuen Arbeitswelt: Nicht mehr Befehlen und Gehorchen stehen da im Mittelpunkt, sondern achtsame Beharrlichkeit, autonome Leistungsbereitschaft und flexible Reaktion; besser noch: Antizipation von ungewohnten Situationen und nicht klar prädizierbaren Aufgaben. Nicht mehr rennen und notfalls treten, lauten deshalb die Forderungen von Trainer und Spiel, sondern „Lösungen finden“; Hochleistungsfußball heute stellt die Spieler eher vor Situationen wie in einer Schulprüfung oder in einem Assessmentcenter: dementsprechend wird das neue Kicker-Personal gecastet und gesiebt in Eliteschulen, Internaten und Nachwuchszentren, muss es sein Talent sofort nach dem Windelalter stetig beweisen und entwickeln; der Nationalmannschaftskapitän Philipp Lahm steht – wie der Verein, für den er spielt, und die Stadt, in der er lebt, also: München und der FC Bayern (2) – beispielhaft für dieses „fokussierte“ Leben („fokussiert“ ist die Lieblingsvokabel von Trainer Löw und seinem Stab), in dem der belohnt wird, der nicht aus der Reihe tanzt, aber mehr leistet, als sich nur an- und einzupassen.
Für die kulturindustrielle Vermarktung des Fußballs ergibt sich daraus übrigens ein bemerkenswertes Dilemma, das Sportjournalist Christoph Biermann in seinem Buch mit dem sicher nicht zufällig gewählten Titel Die Fußball-Matrix offen-naiv beschreibt: „(Die Spieler) sollen Stars sein, aber sich auf dem Platz nahtlos ins Kollektiv einordnen. Sie sollen schnell laufen, fix handeln und dazu noch ihre fußballerischen Eigenheiten pflegen. Das sind verdammt viele Talente auf einmal, die da gefordert sind.“ (3) Eine Situation, die nicht nur im Leistungssport dazu führt, dass die Protagonisten ihre Pubertät schlicht auslassen und denen man das – wie exemplarisch ebenfalls bei Philipp Lahm – auch deutlich ansieht und anmerkt. Nicht einmal wohl inszenierte Skandälchen wie die windelweiche Trainerschelte in der Autobiographie (4) des damals 27-jährigen (!) Vorzeigekickers, -sohnes und -ehemannes oder das ebenso windelweiche öffentliche Nachgrübeln über die Homophobie im Fußball vermochten dem ewig beflissenen Praktikanten-Typ Lahm irgend die Kontur zu geben, die die publizistische Vermarktung wiederum so dringend braucht.
Was natürlich nicht heißt, dass die Typologie Lahm keine soziale Botschaft besäße: Er ist der, der sich in der Schule nicht hängen lässt, der mehr trainiert als er muss, er ist der, der noch Freundlichkeit und gute Manieren in den totalisierten Konkurrenzkampf wirft, in dem nicht mehr harte Fäuste, sondern hartnäckige Beflissenheit zählt.
Die Mannschaft, die von einem Oliver Bierhoff gemanagt und von einem Philipp Lahm aufs Spielfeld geführt wird, ist also keinesfalls mehr das, was Nationalisten wie Antinationale, wenn auch in gegensätzlicher Absicht, in ihr sehen wollen: Sie symbolisiert nicht mehr das rassistisch militarisierte soziale Schutzversprechen – also blonde Teutonen, die sich mit Blutgrätschen zum Erfolg kämpfen –, sondern vielmehr den Appell, sich in einer totalisierten Konkurrenz gefälligst anzustrengen und Misserfolg nur noch als Ansporn für die Zukunft anzunehmen.
So deutlich die Außendarstellung des DFB und seines Vorzeigeteams sich im vergangenen Jahrzehnt geändert hat, so sehr unterscheidet sich auch die öffentliche Inszenierung des nationalen Fußballs von früher: im Stadion wie eben auch auf den öffentlichen Plätzen. Noch 1990, als die DFB-Elf ihren letzten Weltmeistertitel gewann, waren während des Finalspiels die Straßen wie leer gefegt; die Zuschauer hatten sich in Kneipen und Wohnzimmern versammelt, und erst im Laufe des späteren Abends bildete sich dann in allen deutschen Städten der typische Wiedervereinigungsmob, der grölend und auch marodierend durch die Straßen zog und sofort die Assoziation zum Pogrom hervorrief.
Zur Heimweltmeisterschaft 2006 dagegen – natürlich mit dem eingangs bereits erwähnten signifikanten West-Ost-Gefälle – hatte die große Mehrheit verstanden, was ihnen Fischer, Schröder, Merkel, Grönemeyer, Klinsmann und der neue starke Mann des DFB, Theo Zwanziger, nahe legten. Jetzt hieß es, analog zum veränderten Geschehen und Personal auf dem Rasen, nicht mehr, faschistische Blutfeste in Erinnerung zu rufen, sondern zackige Lebensfreude zu leisten; nicht mehr der Schrecken einer bösen, alten Welt zu sein, sondern der Sieger einer schönen, neuen Welt. Deutschland wollte nicht mehr Schläger-, sondern Feierweltmeister werden.
Fanmeilen ohne Generalmobilmachung
Das klappte zum einen, weil ostdeutsche Spielorte soweit wie möglich vermieden wurden, und zum anderen, weil die Identifikation mit der neuen Nationalelf sich in Windeseile vom Reservat des Volkszorns zum Party-Ritual der Fröhlichen und Erfolgreichen wandelte. Träger verpisster Jogginghosen, Hitlergruß-Zeiger und Glatzen sahen sich in der Masse feierwütiger Büromenschen an den Rand gedrängt. Natürlich dient auch ihnen der Nationalismus zur Selbsterhöhung, zweifelsohne. Nur handelt es sich dabei um einen anderen Typus Selbsterhöhung als er bislang bekannt war; es muss nicht mehr die Nation zwischengeschaltet werden, um sich an sich selbst zu berauschen, die nationale Kostümierung ist Zugabe und Anlass, die Begeisterung eines jeden gilt dabei jedoch, wie gesagt, sich selber und nicht mehr Deutschland als einem irgendwie höheren Gut, für das man Gesundheit oder Leben riskieren würde; schon gar nicht auf einem echten Schlachtfeld und nun auch nicht mehr auf dem symbolischen, wie es die Innenstädte der WM-Spielorte für die National-Hools früherer Jahre dargestellt hatten. (5)
Robert Pfaller hat diese postmoderne Mentalität einmal dadurch charakterisert, dass „Ich-fremde Anteile“ nicht mehr aufgenommen, ja nicht einmal toleriert würden, und dass jeder „symbolische Appell“, etwas anders zu sein als man ohnehin ist, als „Übergriff“ des Öffentlichen aufs Eigene verstanden würde. (6) Das wirft nicht nur ein interessantes Schlaglicht auf die Verbots- und Reglementierungsorgien des zurückliegenden Jahrzehnts gerade im öffentlichen Raum, sondern auch auf den Aufstieg des Postnationalismus noch im Gewand des nationalen Fußballs.
Pfaller beschreibt in seinen Essays den Verfall des öffentlichen Raumes und der Fähigkeit zu feiern. Denn, wer an sich nichts mehr zulassen möchte, was er nicht authentisch selber ist, misstraut dem Witz, dem Uneindeutigen, der Schönheit, dem Alkohol und dem Rauch; der misstraut auch jeder Sache, die nicht unmittelbar notwendig ist, deren Nutzen in irgendeiner Zukunft liegt oder deren Früchte er wiederum mit anderen teilen müsste. Nichts darf es geben, das größer und relevanter als man selber ist. Deshalb kam es zur Ausbildung von Reality-TV-Formaten und Doku-Soaps, in denen demonstriert wird, dass die Welt draußen auch nur die Vergrößerung des heimischen Wohnzimmers ist.
Und so feiern die Zuschauer auf den Sommermärchen-Fußball-Festen auch nicht mehr Deutschland als metaphysisches Versprechen, die eigenen antisozialen Gelüste an Anderen straffrei und konsequenzlos abreagieren zu dürfen, sondern schlicht sich selber in ihrem So-sein. Der Alt-Fan war noch auf den Feind bezogen, der Neu-Fan ist es auf sich. Was als Weltoffenheit verkauft wird – und was natürlich objektiv viel angenehmer ist, denn es verzichtet ja definitiv aufs Verletzen anderer –, ist tatsächlich Selbstbezüglichkeit in schlechter Form. Auf den Fanmeilen findet nicht mehr die Vereinheitlichung einer gespielten Generalmobilmachung gegen irgendwelche Erbfeinde statt, sondern die individualisierte Auffälligkeitskonkurrenz monadisierter, mit karnevaleskem Schwarz-Rot-Gold-Nippes behängter, bedeckter und bemalter menschlicher Litfasssäulen. Das erklärt auch, warum man auf den meisten WM- und EM-Events das Spielgeschehen weder optisch noch akustisch überhaupt verfolgen kann; es interessiert ja auch nicht wirklich, bis auf die wenigen Momente, wo tatsächlich Tore fallen, denn da wissen die Protagonisten, dass rasende Freudenausbrüche gefragt sind für Fernsehkameras und Fotografen.
Paradoxerweise zeigt sich die postmoderne Selbstgenügsamkeit gerade an der stark gestiegenen Kostümierungsneigung: Denn die Unfähigkeit zum Feiern von etwas, das größer, gar wichtiger wäre als die eigene Person, kennt nur noch eine Feier, die ihrer selbst. Anders als früher genügt kein Schal oder gar ein simpler Mini-Pin am Revers, um Identifikation mit einer sozialen Gruppe auszudrücken, also in diesem Fall, sich als Anhänger der deutschen Nationalmannschaft auszuweisen. Denn Identifikation setzte ja voraus, dass man eine Grenze zwischen sich und dem Identifikationsobjekt anerkennt, gerade indem man sie zu überbrücken versucht. Wer diese Grenze nicht anerkennen kann, der leugnet den Unterschied durch Verschmelzung: Der eigene Körper wird zu Deutschland, zu einem Deutschland, dessen Grenzen nicht die von 1939 sind, sondern die des Fan-Zylinders, der National-Perücke etc. Der Werbeslogan einer Kampagne für mehr Kinderfreundlichkeit – „Du bist Deutschland“ – spricht dabei die Wahrheit auch aus über jenes neue Nationalgefühl, auf das ein Oliver Bierhoff so stolz ist. Es berauscht sich nicht mehr an der Tradition, sondern am eigenen traurigen Selbst, das sich aus dem nationalen Fundus nur bedient, um dieser Traurigkeit nicht gleich gewahr zu werden: Denn dieses traurige, authentische Selbst könnte aus sich keinen Anlass und keine Utensilien für eine Feier hervorbringen, die leiht es sich aus der modernen Vergangenheit der Postmoderne.
So kommt es auch, dass diejenigen, die am auffälligsten kostümiert und geschminkt antreten, auch diejenigen sind, die kaum wissen, wie es gerade steht, oder welche Kicker sich überhaupt auf dem grünen Rasen befinden, aber auf mediale Nachfrage jede Floskel der „One-World“-Ideologie parat haben. Dass National-Schminksets zum sommerlichen Standard-Repertoire der Discounter gehören, wäre demnach kein Indiz eines überbordenden Nationalismus, sondern eines überbordenden Infantilismus. Die Energien, die die Nationalmannschaft entfacht, sind nicht auf die Nation gerichtet, sondern auf Events, die die Unfähigkeit zu Feier und Öffentlichkeit zu unterbrechen versprechen, ohne die narzisstische Selbstbezüglichkeit aller Einzelnen zu stören. Solcher Nationalismus ist eine ausgehöhlte Schrumpfform seines Vorgängers, denn seine identitären Sehnsüchte sind nicht mehr von Dauer und interessieren sich weder für Maas noch Memel. Nur noch der Event selber vermag zu kollektivieren und das eben auch nur für die Dauer des Events: Die Fähnchen an den Autos kommen und gehen von einem Tag zum anderen, wie auf unhörbaren Befehl; interessant übrigens, dass die Ansteckfähnchen selber ein neues Phänomen sind, denn kaum jemand, der sie ansteckt, würde sich mit einem traditionellen Autoaufkleber etwa ein dauerhaftes nationales Bekenntnis auf den Lack setzen. Die Insignien der Fußballfestwochen sind allesamt abwaschbar und abnehmbar und liegen am Tag nach dem Endspiel schon wie Blei in den Ramsch-Regalen.
Deshalb ist auch kaum auszumachen, wozu dieser Flash-Mob-Nationalismus politisch, also jenseits analytischer Feststellungen zu seinem seelischen Infantilismus, überhaupt fähig sein könnte. Wollte man spekulieren, fiele einem vielleicht eine passive bis scheinmobilisierte Akzeptanz für ein autoritär-technokratisches Regime ein. Was dieser Nationalismus neuen Typs jedenfalls nicht mehr ist, ist hingegen offensichtlich: Nämlich kein Platzhalter eines nationalsozialistischen Kampfverbandes, als welcher der deutsche Nationalfussball mitsamt seiner klassischen Landserfolklore für viele seiner Anhänger über Jahrzehnte fungiert hatte. Eine Entwicklung, die nicht viel mit gewachsener Einsicht zu tun hat, sondern mit gewachsener Unfähigkeit: Der Unfähigkeit zur Libidoübertragung. Klassisch autoritäre Großverbände – Freud nennt das Beispiel der „künstlichen Masse“ Armee – benötigen ein gewisses Quantum Selbstliebe, die ihre Mitglieder von sich abziehen und auf die Organisation beziehungsweise ihre Führer übertragen, um auf Dauer zu bestehen; verstärkte Bindung der einzelnen als Glieder dieser Organisation zueinander und zum Führer erst gewährleistet Disziplin und nicht zuletzt Opferwillen. (7) Die Feier ihrer selbst, die die in Schwarz-Rot-Gold staffierte Monade seit 2006 öffentlich aufführt, steht für das gerade Gegenteil dieser erforderlichen Eigenschaften.
Reclaim the game
Das heißt aber nicht, dass verwandte Formen des öffentlichen Narzissmus immer harmlos ausfallen müssten. Die wahnhafte Verschmelzung von Größenselbst und Gruppenidentität heftet sich jedoch nicht mehr so sehr an das Abstraktum Nation, sondern zielt auf viel näher liegende Identitätsgemeinschaften, oder klar gesagt: Banden. Das Ultra-Phänomen spiegelt im Fußball die Kleinräumigkeit von Restbindung und auch die infantile Neigung, nicht mehr andere, sondern allein sich selbst und maximal andere, die einem aufs Haar wie Klone gleichen, mit Zuneigung zu bedenken; man könnte von einer libidinösen Verengung sprechen, in der Großverbände wie Nationen, Armeen oder Massenparteien keinen Platz mehr finden, sondern maximal ein Block im Stadion.
Ultra zu sein, heißt nämlich zu glauben, dass man als Fan selber Mittelpunkt und Sinn eines Fußballspiels sei: „Reclaim the game“ ist eine Parole, in der sich die sehr berechtigte Forderung nach bezahlbaren Stehplätzen unheilvoll vermischt mit dieser neuen Selbstbezüglichkeit, die nach medialer Aufmerksamkeit giert. Denn sie bedeutet, dass die eigenen minutiös vorbereiteten Choreos (8), das spannend-illegale Einschmuggeln und Abbrennen von Pyros, die durch Kleidung und Gesänge eingegrenzte Gruppe mit klaren Hierarchien von vorturnendem „Kapo“ und mitmachendem Fußvolk allesamt wichtiger werden als das Spiel, die Spieler und sogar der Verein, den zu unterstützen man doch vorgibt. Hier auf den kleinräumigen Archipeln des Regionalen, ja: Subregionalen wird der beschriebene Schrumpf-Narzissmus wieder wirkmächtig und gewalttätig: Hier gibt es die Eigenen und die Anderen in einer derartigen Beengtheit, dass hier – und nicht vor den Großbildwänden der Fanmeilen – die aggressiv-paranoide Seite der Selbstfeier sichtbar wird. „Wenn wir absteigen, dann schlagen wir Euch tot“, eine Parole, die in den Ultra-Hauptstädten Köln und Frankfurt gängig ist, drückt es aus: Nicht der Lieblingsverein steigt ab, „wir“ sind es; die Ultras tun ihrer Meinung nach das Ihre dagegen, indem sie in Stunden der Not den Platz stürmen, die eigenen Spieler bedrohen, sich stolz wie die Frankfurter in der vorletzten Abstiegssaison per Riesentransparent am letzten Spieltag zum „Deutschen Randalemeister“ küren und dergleichen mehr.
Das ist aber keineswegs zu verwechseln mit dem proletarischen Hooliganismus früherer Jahrzehnte: Der war alles andere als kreativ, der war nur handgreiflich, letztlich eben jene SA-Reserveübung, von der eingangs die Rede war, die zumeist abseits der Kameras auf Parkplätzen und Autobahnraststätten stattfand. Der Wettstreit der Ultras hingegen um die auffälligsten Choreos, die beste Provokation des Gegners, das einschüchterndste Feuerspektakel, den markerschütterndsten Gesang, ist ein getreues Abbild der Präsenz- und Präsentationspflicht auf dem Arbeitsmarkt; ganz betont unpolitisch und scheinbar autoritätskritisch (nicht umsonst ist der Großverband DFB der gemeinsame Hauptfeind aller Ultras), aber engagiert bis in die Haarspitzen. Hier wie da, bei der Arbeit und im Stadion, geht es um Projekte, in die die Einzelnen sich mit Haut und Haar einbringen müssen, um anerkannt und aufgenommen zu werden. Bloßer Konsument eines Fußballspiels darf man nicht mehr sein, sondern Krieger in einem symbolischen Wettbewerb gegen die Krieger des Konkurrenzunternehmens; und schwer wäre zu sagen, ob es sich dabei hauptsächlich um eine Sportifizierung des Arbeitslebens handelt oder, umgekehrt, um eine Ausdehnung des Arbeitskrieges auf die Ränge der Stadien. Es ist sicher kein Zufall, dass diese drei Entwicklungen gemeinsam und synchron das zurückliegende Fußballjahrzehnt in Deutschland geprägt haben: Der Siegeszug des zivilisierten Spielers mit fokussiert-pubertätsfreiem Lebenslauf, die Attraktivität der Ultras und die postnationale Transformation des DFB.
Eine Elf der Deutschen
Doch die Widerstände gegen diese Transformation sind groß und nicht völlig zu vernachlässigen. Denn es ist ja nicht allein der Frust der Neonazis über die unechten Deutschen in der Nationalmannschaft, der da grummelt und mosert. Dass Löws und Bierhoffs neues Fußball-Deutschland die national-sozialen Schutzbedürfnisse Vieler enttäuscht, wurde gerade in den letzten Monaten seit der EM offensichtlich: Jetzt nämlich, wo Löws Umstellung auf modernen Fußball mit spielerischer Brillanz, Dominanz, geschmeidigem und aufmerksamem Passspiel, also dem perfekten Fußball des Praktikantenzeitalters, Schattenseiten offenbart, sprich: zu viele leichte Tore gegen die auf Offensive gepolte Mannschaft fallen, rührt sich Ärger allenthalben.
Und das nicht aus sportlicher Enttäuschung über das Ausscheiden durch Italien im Halbfinale, denn recht viel mehr Erfolg, als Klinsmann und dann Löw in den vergangenen Jahren hatten, kann man kaum haben. Daran erinnerte nicht zuletzt der Trainer des amtierenden Europa- und Weltmeisters Spanien, Vincente Del Bosque, als er den deutschen Löw-Kritikern nach den 4 Toren der Schweden gegen Deutschland in der WM-Qualifikation ins Gewissen redete: „Wir haben 34 Jahre auf einen Titel gewartet, man kann nicht alles daran messen.“ (Bild, 26.10.2012)
Es ist also nicht diese Ungeduld, die die Kritiker umtreibt, allen voran Kicker-Herausgeber Rainer Holzschuh, der nach dem Schweden-Spiel nach „echten Führungspersönlichkeiten“ verlangte (17.10.2012), Es ist das sozusagen Undeutsche an Auftreten und Spielstil der Nationalmannschaft. Das stört viele: Eine Nationalelf der Deutschen, die keinen Titel gewinnt, muss dann gefälligst so sein, wie man es gewohnt war: eine antiquierte Spielauffassung durch Kampfgeist wettmachen; sie muss hässlich und bösartig auftreten, verabscheut werden, erst dann schmecken auch kleine Erfolge süß. Und sie muss vor allem abwehren, sie muss in der Defensive stark sein: so wie der Nationalstaat alter Prägung die zersetzende Wirkung des Marktes abwehrte und in stabil-verlässliche Lebensformen goss – so spielte auch einst die Nationalmannschaft. Ein solches Staats-Team hätte kein 4:4 wie jüngst das DFB-Team gegen Schweden zugelassen, das löst Panik aus. Denn einen 4:0-Vorsprung nach 60 Minuten, den gab man einst ebenso wenig her wie die D-Mark. Doch genau so wie Merkel solchen D-Mark-Träumen nicht nachgeben kann, werden auch Löw und der DFB sich nicht abbringen lassen vom postnationalen Erfolgskurs auf und neben dem Platz. Kurz und bündig bescheidet der Bundestrainer deshalb dem Chor der Murrenden via Bild (26.10.2012): „Wenn man meint, dass uns derjenige fehlt, der dazwischen haut, auf Freund und Feind einschlägt, um etwas zu bewegen, den haben wir nicht“ und den wolle man auch nicht mehr, denn: „Blindes Grätschen ist bei uns nicht gefragt.“
Und so wenig, wie Typen à la Sammer, Matthäus oder Ballack zurückkehren werden, so wenig werden die Festivitäten rund um die internationalen Fußballturniere wieder zu militanten nationalen Notstandsübungen werden. Auch in Zukunft werden die Fanmeilen anderen penetranten öffentlichen Langweiler-Aufläufen gleichen wie beispielsweise dem Oktoberfest. Und deshalb sollte das turnusmäßige Sommermärchen, das 2014 mit der WM in Brasilien wieder ansteht, keinesfalls Anlass zu politischer Gegenagitation geben. Denn sie verfehlt ihren Gegenstand völlig, ja, sie macht sich mit aller Gewalt dumm, nur um billigen Distinktionsgewinn zu ziehen. Das Einzige, was man guten Gewissens empfehlen kann, ist eine Übung in Des-Engagement: Und dazu genügt es schon, einen Bogen um öffentliche Leinwände zu machen und kein Fähnchen ans Auto zu stecken.
Uli Krug (Bahamas 65 / 2012)
Anmerkungen:
- Zitiert nach dem sehr guten Text Schland-Partypatriotismus: Nur uneigentliche Hysterie? des Aktionsbündnisses gegen Wutbürger; zu finden unter: http://abgwb.wordpress.com/2011/10/09/sch land-partypatriotismus-nur-uneigentliche-hysterie
- Dass sich die Ultras dieses Vereins Schickeria nennen, ist kein Zufall. In dieser Namensgebung spiegelt sich eine für die Vereinsmentalität typische soziale Distinktionswut, die man in Reinform bei einer Aktion der Bayern-Südkurve 1997 im Spiel gegen Beşiktaş Istanbul studieren konnte: Die Aldi-Tüten, die den Türken entgegengereckt wurden (Motto: „Aldi grüßt Kunden“), kündeten aber eben nicht von Rassismus, sondern von einer Art Sozialdarwinismus, demzufolge sich der „Survival of the fittest“ nicht mehr an Haut-, sondern an Vereinsfarben entscheidet. Dass sich daran in den letzten Jahren nichts geändert hat, bewies im vergangenen Jahr eine über Wochen andauernde Aktion, in der Bayern-Anhänger Verkehrsschilder in den hyperteuren Münchner Innenstadtvierteln, in denen ein Quadratmeter nicht mehr unter 15 Euro/Monat zu mieten ist, mit Riesenfolien überklebten. Sie deklarierten diese Gebiete zu „Löwenfreien Zonen“, also zu Gebieten, in denen Anhänger des deutlich schlechter betuchten Lokalrivalen 1860 München nicht mehr leben könnten und dürften.
- C. Biermann: Die Fußball-Matrix. Auf der Suche nach dem perfekten Spiel, Köln 2010, 157
- Philipp Lahm: Der feine Unterschied, München 2011.
- Noch 1998 beispielsweise hatten deutsche Schlägertruppen den französischen WM-Spielort Lens quasi eingenommen und die schlecht vorbereitete Polizei gewalttätig aus der Innenstadt vertrieben.
- Vgl. Robert Pfaller: Wofür es sich zu leben lohnt. Und was uns das vergessen lässt: Über-Ich, Narzissmus, Beuteverzicht, in: C. Menke / J. Rebentisch: Kreation und Depression – Freiheit im gegenwärtigen Kapitalismus , Berlin 2010, 198 ff. Dass Pfaller hier seine psychoanalytischen Einsichten mit einer kruden Kritik am „Neoliberalismus“ verbindet, schmälert zwar das Lesevergnügen, aber nicht das Zutreffen seiner psychoanalytischen Erwägungen.
- Vergleiche Sigmund Freud: Massenpsychologie und Ich-Analyse, in: Studienausgabe in zehn Bänden, Bd. 9: 61–135, insbesondere 89 f.
- Abgeleitet von Choreographie: einstudierte auf optische und akustische Aufmerksamkeit zielende Aktion eines Fanblocks, bei dem beispielsweise ein selbst gebasteltes Riesentransparent in Trikotform hochgezogen oder mit eigens verteilten farbigen Papierblättern in Vereinsfarben gewunken wird. Ziel sind die Fernsehkamera und die gegnerischen Ultras, die es im Spektakel zu übertrumpfen gilt. Gern werden auch Leuchtfackeln und ähnliche pyrotechnische Utensilien verwendet, die insbesondere unter Flutlicht eine martialisch-kriegerische Atmosphäre erzeugen.
SPALTE3-AKTUELL-RUBRIK
Frühere Aktivitäten sind im Aktuell-Archiv aufgeführt. Dort gibt es auch einige Audio-Aufnahmen.
Alle bisher erschienenen Ausgaben der Bahamas finden Sie im Heft-Archiv jeweils mit Inhaltsverzeichnis, Editorial und drei online lesbaren Artikeln.