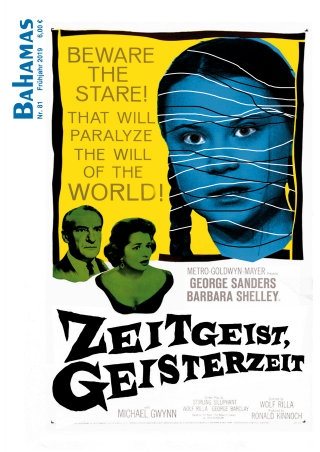Härtere Zeiten
Von der „doppelten Staatsbürgerschaft“ zur „Non-Citizenship“
Aus unseren bisherigen Ausführungen dürfte aber wohl deutlich geworden sein, dass der Aufbau einer multikulturellen Immigrationsgesellschaft in einem relativ homogenen Nationalstaat problematisch und eigentlich nicht zu verantworten ist.
Wahre Demokratie, darin ist sich der deutsche Verhaltensforscher mit Wolfgang Schäuble und den Nationalsozialisten einig, braucht Vertrauen. Vertrauen ist das moralempfindelnde Surrogat für Rationalität, die in Deutschland stets Fremdwort wie Fremdkörper geblieben ist. Wo mit rational begründeter Zustimmung zu politischen Entscheidungen nicht zu rechnen ist, der Laden aber trotzdem zusammengehalten werden soll, wird daher um Vertrauen geworben, an das Deutsche gern appellieren, wenn die Vernunft zum Misstrauen rät. Insofern ist das Titelschlagwort von Eibl-Eibesfeldts 1994 erschienenem Bestseller ein Pleonasmus. Jede Gesellschaft, die so genannt zu werden verdient, gibt Misstrauen Raum und befördert seine öffentliche Artikulation, weil vernünftiger Streit von dem in Worte gefassten Zweifel lebt. Wer ihn exorzieren möchte, betreibt die Zerstörung von Gesellschaft im Namen von Gemeinschaft, deren Einheit statt durch Urteilskraft durch Vertraulichkeit, durch in Nestwärme konvertierte Gewalt, gestiftet wird. Wenn Eibl-Eibesfeldt den Versuch rügt, aus dem „homogenen Nationalstaat“ eine „multikulturelle Immigrationsgesellschaft“ zu machen, stellt er unter Beweis, dass er Nationalstaatlichkeit so wenig denken kann wie Gesellschaftlichkeit. Homogen ist ein bürgerlicher Nationalstaat allein in der allerdings entscheidenden Hinsicht, dass er das Prinzip völkischer Homogenität, das ein Prinzip der Partikularität ist, zugunsten der Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz suspendiert. Deshalb sind klassische Einwanderungsländer wie die Vereinigten Staaten Einwanderungsgesellschaften, während Eibl-Eibesfeldts „multikulturelle Immigrationsgesellschaft“, als Nebeneinander der Kulturgemeinschaften, buchstäblich asozial wäre. Eine solche als Gesellschaft drapierte Multikulturgemeinschaft widerspricht nun aber tatsächlich dem Prinzip der Gleichheit aller Bürger, weshalb Eibl-Eibesfeldt versehentlich trotzdem eine Wahrheit ausspricht: Nationalstaatlichkeit, die sich als Organisationsform von Kulturgemeinschaften versteht, untergräbt ihre eigenen Bedingungen.
Die zeitgemäßen Nachfahren Eibl-Eibesfeldts sind nicht die rechten Ethnopluralisten, über die die üblichen antideutschen Vortragsreisenden nur deshalb dauernd referieren, weil gemeinsam mit ihnen unter dem Schlagwort des „Rechtpopulismus“ gleich auch alle Verteidiger bürgerlicher Souveränität denunziert werden können, sondern die diversitätsbesoffenen Geflüchtetenfreunde, die agieren, als wollten sie Eibl-Eibesfeldt verhaltensforscherisch widerlegen: Es gehöre nicht zum evolutionsbiologischen Erbe des Homo sapiens, die Nähe der ihm Ähnlichen zu suchen, vielmehr bestehe gelebte Menschlichkeit gerade darin, sich solchen Kulturen zu öffnen, die Öffnung nur als Unterwerfung dulden – ein Rigorismus, den die Deutschen auch deshalb so gut verstehen, weil sie ihn von sich selber kennen. Anders als die Beschwörung von Toleranz und Vielheit vorgaukelt, ist das Ziel solcher Politik gleichfalls flächendeckende Homogenität qua Kassierung aller Vermittlungen, Unterscheidungen und Nuancen, die die Zivilisation auf dem Weg der Transzendierung des Ethnos im Demos hervorgebracht hat. Weil die Politik der Diversität sich mit der völkischen Homogenitätspropaganda im Hass auf jegliche Spuren solcher Vermittlung und Unterscheidung einig ist, fällt sie heute auf der Höhe antinationaler Großraumpolitik in Demographie, Ethnographie und letztlich Zoologie zurück: Die Volksgemeinschaft ersteht wieder als Multikulturbiotop, in dem die robustesten Arten überleben.
Ethnos versus Demos
Das rechtliche Instrument, um den Primat des Ethnos über den Demos als Teil einer vermeintlich aufgeklärten Staatsräson zu implementieren, war in Deutschland seit jeher die doppelte Staatsangehörigkeit. Diese ist keine Erfindung der Grünen, sondern gehörte zu den Rechtsvorstellungen des Nationalsozialismus und erlebte ihr Revival im Lauf der 1980er Jahre zunächst ideell als Gegenentwurf zum in der Bundesrepublik schon damals nur noch eingeschränkt geltenden ius sanguinis (1) und seit dem 1. Januar 2000 praktisch: Damals wurde das Geburtsortprinzip für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern eingeführt, sofern ein Elternteil zum Zeitpunkt der Geburt seit mindestens acht Jahren seinen rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland hat. 2014 entfiel gemäß Beschluss der Großen Koalition für solche Kinder auch die zuvor geltende Optionspflicht, also die Notwendigkeit, sich bis zum 22. Lebensjahr für eine der beiden Staatsbürgerschaften zu entscheiden. (2) Während die zivilgesellschaftliche Öffentlichkeitsarbeit vom „No border“-Camp über migrationspolitische Nichtregierungsorganisationen bis zur Bundeszentrale für politische Bildung die voranschreitende realpolitische Durchsetzung der deutschen Liebe zum Doppelpass durchweg als Sieg des aufgeklärten ius solis über das rassistische ius sanguinis lobt, (3) fällt historisch auf, dass Deutschland seit dem späten 19. Jahrhundert die doppelte Staatsbürgerschaft stets als Mittel in Dienst nahm, das ius sanguinis nicht zu suspendieren, sondern auszudehnen, um auch anderen Nationalstaaten den Primat des Ethnos als Organisationsform aufzuzwingen und damit deren Souveränität auszuhöhlen. Dass Großbritannien im Ersten Weltkrieg mit der Kategorie des enemy alien zum Zweck antideutscher Feindbekämpfung den bis dahin gültigen Vorrang des Territorialprinzips gegenüber dem Abstammungsprinzip im Staatsbürgerschaftsrecht zurückstellte und ab 1918 mit dem British Nationality and Status of Aliens Act die Bürgerrechte naturalisierter gegenüber denen eingeborener Briten einschränkte, (4) war nicht einfach eine Regression auf die dem britischen Recht im Grunde fremde Abstammungsgemeinschaft. Vielmehr antworteten solche Maßnahmen auf den Verdacht, die im Staatsangehörigkeitsgesetz des Deutschen Reiches festgeschriebene Möglichkeit der Doppelstaatsbürgerschaft für deutsche Staatsangehörige (5) sei ein Versuch systematischer Reethnisierung der in anderen Nationalstaaten lebenden Gemeinschaften Auslandsdeutscher, kurz gesagt: staatsbürgerrechtlich camouflierter Imperialismus. Aus dem gleichen Grund hatte Frankreich schon 1915 Vorschriften erlassen, die es ermöglichten, Staatsbürgern mit doppelter Staatsangehörigkeit unter bestimmten Bedingungen, etwa im Fall der Unterstützung einer feindlichen Macht, die französische Staatsangehörigkeit wieder zu entziehen.
Obgleich sich die Kategorie des enemy alien schon damals als wenig probates Mittel gegen den deutschen Expansionismus erwies, sondern eher zusätzliche Schwierigkeiten schuf (so wurden in ihrer Folge probritische deutschstämmige Briten Opfer deutschenfeindlicher Ausschreitungen (6)), entbehrte auch ihre teilweise Wiederbelebung während der Zeit des Nationalsozialismus, als sie zahllose deutsche Juden traf und damit den so aporetischen wie zwingenden Zusammenhang von Staatsbürgerschaft und Menschenrechten schroff ins Licht rückte, (7) nicht einer gewissen Konsequenz. Komplementär zur Ausbürgerung jüdischer deutscher Staatsbürger, die als deklarierte Vertreter der „Gegenrasse“ nach deutschem Willen nicht nur im Reichsgebiet, sondern weltweit als Staatenlose für vogelfrei gelten sollten, setzte die eben nicht nationalistische, sondern expansiv antinationale Politik des „Dritte Reiches“ gezielt „die Doppelstaatsangehörigkeit als Mittel der Integration eines großgermanischen Europa“ ein: „Im Rassekrieg war nicht mehr die Staatsangehörigkeit, sondern die rassische Zugehörigkeit ausschlaggebend für die Rekrutierung der europäischen Armeen des Deutschen Reiches.“ (8) Die damit vollzogene „Integration“ war freilich zugleich Desintegration: In den folgenden Jahren wurde das Prinzip der Staatsangehörigkeit durch Schaffung eines Dickichts von Sondertiteln („Schutzangehörige“, „Fremdvölkische“, „Deutsche auf Widerruf“, „Rückdeutschbare“ usw. (9)) zum Instrument eines rassepolitischen Voluntarismus, dessen einzig verlässlicher Zweck darin bestand, die Angehörigen der „Gegenrasse“ als potentiell weltweite Nicht-Staatsbürger, als der Vernichtung preisgegebene Schutzlose zu setzen. Die zeitweilige Reinstallation des Abstammungs- gegenüber dem Territorialprinzip durch die staatsbürgerrechtlich fortschrittlichen westlichen Nationen, allen voran Großbritannien und die USA, war eine Reaktion auf die nicht länger nationalstaatlich eingehegte Expansion des Prinzips des Ethnos durch die deutsche Eroberungspolitik, die immer eine Politik der Ausbürgerung war: Die Ausbürgerung jüdisch identifizierter deutscher Staatsbürger ging dem deutschen Vernichtungskrieg voraus.
Der heute konsensuale Antinationalismus, der schon allein die Tatsache, dass Nicht-Staatsbürger in bürgerlichen Nationalstaaten nicht die gleichen Rechte genießen wie Staatsbürger, für protonazistisch erklärt und demgegenüber den Doppelpass als Signum einer liberalen Staatsbürgerschaftspolitik lobt, betreibt insofern Geschichtsfälschung. Die doppelte Staatsbürgerschaft war, vor allem in Deutschland, nie der Universalisierung bürgerlicher Rechte verpflichtet, sondern impliziert, solange das Prinzip des Ethnos nicht in einer freien Weltgesellschaft transzendiert ist (also bis auf Weiteres), immer die Gefahr einer Reethnisierung von Staatsbürgerschaft und einer Unterhöhlung ihrer fortschrittlichen Bedeutung, die diese nur so lange besitzt, wie sie nicht gedoppelt – und das heißt: geteilt – wird. Seit im Zuge des ersten massenhaften Zuzugs von Arbeitsmigranten aus der Türkei in den 1960er Jahren die Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft in der Bundesrepublik diskutiert wird, führen deren Befürworter monoton und unbeirrbar das Argument ins Feld, die Doppelung der Staatsbürgerschaft sei fortschrittlich, weil durch sie auch die mit der Staatsangehörigkeit verbundenen Rechte gleichsam gedoppelt würden: Wahlberechtigung im Herkunfts- wie im Zielland, Gleichberechtigung beim Arbeits-, Ehe- und Erbrecht, beim Recht auf Erwerb von Grundbesitz, Erleichterung der Ein- und Ausreise usw. Stillschweigend wird dabei unterstellt, dass die Nationalstaaten, die die Doppelstaatsbürgerschaft jeweils gewähren, sich beide dem Primat des Demos gegenüber dem Ethnos verpflichtet fühlen und die jeweilige Staatsangehörigkeit ihrer Bürger nicht zur Erpressung kulturell begründeter Loyalität nutzen. Sobald einer der beteiligten Staaten diese Voraussetzung unterläuft, kann der Doppelpass aber buchstäblich zum Mittel kultureller Geiselhaft werden – wobei sich dann enthüllt, dass eben diese Möglichkeit ihm von Beginn an innewohnte und durch seinen vermeintlichen Nutzen in einer postnationalen Weltgemeinschaft nur verdeckt worden ist.
Es ist kein Zufall, dass diese Problematik sich in der Bundesrepublik in den vergangenen Jahren besonders drastisch an den sogenannten Deutschtürken erwiesen hat. Deren doppelte Staatsbürgerschaft erleichtert es nicht nur – wie im Fall von Deniz Yücel – dem türkischen Staat, sie bei unbotmäßigem Verhalten zu inneren Staatsfeinden zu erklären und entsprechend zu sanktionieren, sondern bestärkt auch umgekehrt deutsche Staatsangehörige türkischer Herkunft darin, sich statt als Staatsbürger als Zugehörige ihrer Kulturhorde zu begreifen, also die ethnisch gefasste Loyalität gegenüber ihrem Herkunftsland gegen die Loyalität gegenüber dem deutschen Staat geltend zu machen und auch in sonstigen Verkehrsformen ihrer Kultur gegenüber der Gesellschaft, in der sie leben, absoluten Vorrang einzuräumen. Dass die doppelte Staatsangehörigkeit deshalb, insbesondere wenn ihre Träger islamischer Herkunft sind, die Reethnisierung von Staatsbürgerschaft und die Aushöhlung des bürgerlichen Nationalstaats befördert, hat z.B. Serap Çileli gezeigt, die als Gastarbeiterkind der ersten Generation Ende der 1960er Jahre mit ihrer Familie von der Türkei in die Bundesrepublik kam, dort 1978 mit zwölf Jahren zwangsverlobt wurde, nach einem Selbstmordversuch und weiteren Zwangsverlobungen zeitweise in einem Frauenhaus lebte und seither über das islamische System von Zwangsheirat, Verstoßung, Ehrenmord und Töchterloyalität publiziert. (10) Çileli hat darauf hingewiesen, wie die doppelte Staatsbürgerschaft die freiwillige oder erzwungene Unterwerfung der Individuen unter den Primat von Kultur und Ethnos befördert, der durch das Prinzip der Staatsbürgerschaft eigentlich neutralisiert werden soll. Die Gründe, die für den Doppelpass sprechen, liegen, so Çileli, allesamt auf der Ebene gefühlter Verpflichtung gegenüber der eigenen Herkunft, stärken also von sich aus bereits das Prinzip des Ethnos gegenüber dem Demos: „Die häufigste Ursache für Zweifel an der Entscheidung (für die alleinige deutsche Staatsbürgerschaft, S.S.) sind emotionale Motive. Dabei handelt es sich um die Verbundenheit mit dem Herkunftsland aufgrund der elterlichen Wurzeln. […] Die Qualität des Ausbildungssystems, der Rechtsstaat, die wirtschaftliche Leistungskraft und bessere berufliche Perspektiven sind wichtige Argumente für die deutsche Staatsangehörigkeit.“ (11)
Im Beharren auf der vermeintlichen Fortschrittlichkeit der doppelten Staatsangehörigkeit steckt somit ein Bekenntnis zum Primat der Herkunftsgemeinschaft über der Aufnahmegesellschaft. Für den Doppelpass gibt es im Grunde, so Çileli, keine rationalen, sondern nur rational camouflierte Motive, im Sinne gesellschaftlichen Fortschritts ermöglicht er nichts, was nicht auch auf andere Weise durchgesetzt werden könnte: „Die doppelte Staatsangehörigkeit hat keine signifikanten Vor- oder Nachteile. Bilaterale Abkommen, nationale Programme wie die ‚blaue Karte‘ […] kompensieren Nachteile, die sich aus einer einzelnen Staatszugehörigkeit ergeben könnten.“ Die politischen und gesellschaftlichen Defizite, auf die die Beliebtheit des Doppelpasses verweist, ließen sich durch Reformen des jeweiligen Staatsbürgerschaftsrechts beheben, ohne dass dafür eine doppelte Staatsbürgerschaft eingeführt werden müsste. Deren Popularität in der Bundesrepublik erklärte Çileli 2013 anlässlich der Diskussion um die Optionspflicht mit einer ethnischen und demographischen Prinzipien verhafteten Bevölkerungspolitik: „Mit rund 3 Millionen Menschen bilden die Türken die größte Migrantengruppe, darunter etwa 700.000 Wahlberechtigte. Wenn man bedenkt, dass beispielsweise die letzten Landtagswahlen in Niedersachsen mit nur etwa 12.000 Stimmen Unterschied entschieden wurden, dann sind die Türken ein großer Wählerpool. Mit etwa 1.1 Millionen wahlberechtigten Muslimen in Deutschland profitiert die SPD am stärksten, denn einer Studie zufolge würden 35 Prozent aller Muslime sie wählen. Stimmen, die die SPD dringend benötigt, denn ihre Mitgliederzahl sank zuletzt auf ein Rekordtief. Die Grünen bilden mit 18 Prozent die zweitbeliebteste Partei für Muslime. Die Union kommt lediglich auf 4 Prozent.“ Indem sie die Diskussion um den Doppelpass aus diesem Grund allerdings zur „Symbolpolitik“ erklärt, umgeht sie, dass die Deutschtürken für den türkischen Staat ein wichtiges Mobilisierungs- und Hetzpotential darstellen, wie es in den vergangenen Jahren angesichts der proislamischen Propaganda Erdoğans und seiner Helfercliquen auf deutschem Staatsgebiet evident geworden ist. Je wichtiger moslemische Wähler für die deutschen Parteien werden, desto größer wird die Gefahr, dass unter dem Deckmantel einer Einbürgerung, die als Modus „kultureller Anerkennung“ in Wahrheit die Ethnisierung von Staatsbürgerschaft betreibt, die Selbstentbürgerlichung des Nationalstaats vorangetrieben wird.
Im Gegensatz zur Bezeichnung für die Verschränkung von Ethnos und Demos in den Vereinigten Staaten, in der die Herkunft zum Anhängsel, gleichsam zum bloßen Kulturschmuck der geltenden Staatsangehörigkeit wird („Afro-American“ usw.), spricht die hierzulande gängige Rede von den „Deutschtürken“ aus, dass diese substantiell Türken und nur nebenher Deutsche seien. Trotz der voranschreitenden Selbstethnisierung insbesondere islamischer Communitys weltweit ist darin ein immer noch gegenwärtiger Unterschied der Staatsbürgerschaftskonzepte in den USA und in der Bundesrepublik festgehalten. Während der Erwerb der Staatsbürgerschaft im ersten Fall untrennbar mit dem Versprechen verbunden ist, sich vom Sog der Herkunft zu lösen, geht hierzulande mit der als „kulturelle Bereicherung“ aufgefassten Einbürgerung der Wunsch einher, jenen Sog unausweichlich werden zu lassen, ob die Angehörigen der jeweiligen „Kultur“ diesen Prozess befördern oder nicht. Darum ist das deutsche Lamento von „Anerkennung“ und „Vielfalt“, das ausgerechnet bei moslemischen Migranten sofort einsetzt, das genaue Gegenteil zum Ideal des melting pot. Kulturelle und ethnische Differenzen sollen demnach nicht absorbiert und in einer gelingenden Gesellschaft überschritten, sondern als unveränderliches und unbedingt zu respektierendes Erkennungsmerkmal fixiert werden: Vergesellschaftung als Desozialisierung.
Asylbewerber und „Geflüchtete“
Die unter anderem infolge ausländerfeindlicher Pogrome in Hoyerswerda und andernorts 1993 beschlossene Neuregelung des bundesdeutschen Asylrechts, die längst nicht nur von Antideutschen mit guten Gründen als Rechtsbruch zwecks Stärkung volksstaatlicher Momente des Nationalstaats angeprangert worden ist, (12) entpuppt sich vor diesem Hintergrund retrospektiv weniger als ein Schritt zurück zum Primat völkischer Homogenität denn als ein Schritt voran zu einer antinationalen Multikulturgemeinschaft, die offen oder verdeckt individuelle Rechte in Gruppenrechte verwandelt und damit ihren Geltungsgrund aushöhlt. Indem das Grundrecht auf Asyl aus Art. 16 Abs. 2 in den neu geschaffenen Art. 16 a des Grundgesetzes transponiert wurde, schränkte der Gesetzgeber den Rechtsschutz von Asylbewerbern drastisch ein und schuf mit dem ebenfalls in Art. 16 a ausgeführten Prinzip der „sicheren Herkunftsstaaten“ Kriterien, (13) die eine Transformation des Asylrechtsanspruchs von einem individuell einklagbaren Grundrecht in ein „kulturell“ begründetes Gruppenrecht vorbereiteten. Die Kritik an diesen Kriterien, die mit Blick auf die Maghreb-Staaten heute durchaus triftig von den Grünen formuliert wird, (14) vermag den Vorrang der Gruppen- vor den Individualrechten aber nicht zu thematisieren, solange nicht der Glaube an den schützenswerten Charakter fremder „Kulturen“ aufgegeben wird, den die Grünen wie das Vaterunser herunterbeten: Weil sich kaum jemand auszusprechen traut, dass der Islam nicht einfach die „Kultur“ darstellt, die die Verfolgten mit ihren Verfolgern teilen, sondern dass der Islam selbst die Bedrohung ist, vor der die vor ihm Flüchtenden zu schützen wären (weshalb eine fortschrittliche Einwanderungspolitik in dem Sinne antimoslemisch zu sein hätte, wie sich dem Islam Abtrünnige als „Ex-Muslime“ bezeichnen), weil man also vom Primat des Gruppenrechts auch dort nicht lassen möchte, wo er sich als Ausdruck und Verstärkung kultureller Barbarei erweist, kann man Homosexuelle, Frauen, Atheisten, Christen und andere in diesen Ländern vom Islam mit dem Tode Bedrohte wieder nur als Partikularkollektive, als „vulnerable Gruppen“ fassen. (15) Wird das Modell der „sicheren Herkunftsstaaten“ jedoch komplett aufgegeben, befördert man unter den Bedingungen des Primats des Gruppen- vor dem Individualrecht nur zusätzlich eine Situation, in der mit den vor dem Islam Flüchtenden die Fluchtursache gleich mit ins Land geholt wird und sich das Recht des Stärkeren, das das einzige Recht im Islam ist, auch im Zielland etabliert.
Dass die Bezeichnung Asylant oder Asylbewerber für Aspiranten auf einen gesetzlich garantierten Rechtstitel mittlerweile als rassistische Beschimpfung gilt und stattdessen am liebsten von „Geflüchteten“ gesprochen wird, reflektiert die Transformation des Asylrechts vom Individual- zum Gruppenrecht, die dem Islam in die Hände spielt. Der Asylbewerber ist schon dem Namen nach jemand, der einen ihm juristisch zustehenden Status einklagt; der „Geflüchtete“ bleibt auch sprachlich Teil jener Zeit und jenes Ortes, aus denen er kommt. Die erste Bezeichnung impliziert wenigstens als Telos die Anerkennung als freier und gleicher Bürger durch das Aufnahmeland; die zweite fixiert die kulturelle Identität des Herkunftslandes. Die Aufweichung des individuellen Grundrechts auf Asyl erweist sich so, anders als die damaligen Kritiker, die auch heute mehrheitlich nichts davon wissen wollen, es sich hätten träumen lassen, keineswegs als Instrument zur Herstellung eines homogenen deutschen Volksstaates, sondern als Schritt auf dem Weg in jenes transnationale Nebeneinander homogener Zwangskollektive, das gemeint ist, wenn die Lautsprecher deutscher Migrationspolitik heute die „multipolare Weltordnung“ beschwören und die einstigen alliierten Siegerstaaten in hybridem Sündenstolz vor „nationalen Alleingängen“ warnen. Das einzige Gebilde, in dem solche Transnationalisierung kultureller Gewalt ein reales Korrelat hat, ist nicht einmal die EU, sondern die Umma, weshalb zwar nicht de jure, aber de facto (16) schon jetzt viele Flüchtlingsunterkünfte in Westeuropa eher der Scharia als dem bürgerlichen Recht unterstehen.
Die russisch-jüdische Philosophin Ayn Rand, die nach der Enteignung ihrer Familie im Zuge der Oktoberrevolution 1926 in die USA emigrierte und heute vor allem als Propagandistin eines beinharten Ego-Kapitalismus gilt, hat den regressiven Charakter jeglichen Gruppenrechts in ihrem Buch The Virtue of Selfishness mit einer Auffassung von Antirassismus in Verbindung gebracht, in der „Rasse“ als positiver Bezugspunkt kollektiver Rechte figuriert, die eben dadurch zu Vorrechten, also zum Unrecht werden. Rands euphorische Bewunderung der USA dürfte auch damit zusammenhängen, dass sie die Organisationsform der vereinigten Staaten als Gegenentwurf zur Sowjetunion, in der ethnische Gegensätze ideologisch sistiert, aber nicht aufgehoben wurden, besonders genau wahrgenommen hat. In ihrem 1963 geschriebenen Text „Kollektive ‚Rechte’“ hält sie, mit Blick auf die antikolonialen Befreiungsbewegungen, aber auch auf die Rassenkonflikte in den USA, den Primat des Begriffs des Rechts über jegliches Kollektiv fest: „Eine Gruppe als solche hat keine Rechte. Ein Mensch kann durch Beitritt zu einer Gruppe weder neue Rechte erwerben, noch die Rechte verlieren, die er bereits besitzt. Das Prinzip individueller Rechte ist die einzige moralische Basis aller Gruppen oder Organisationen. Jede Gruppe, die dieses Prinzip nicht anerkennt, ist keine Organisation, sondern eine Verbrecherbande. Jede Theorie von Gruppenaktivitäten, die individuelle Rechte nicht anerkennt, predigt Gangherrschaft oder Lynchjustiz.“ (17) Die Bildung von Organisationen folgt demnach immer schon dem Prinzip einer freien Assoziation der Individuen, das von jeglicher Gruppenbildung geachtet werden muss. Gruppen, die den in ihnen zusammengefassten Individuen Sonderrechte verschaffen oder sie in ihren Individualrechten beschneiden, bedienen sich erpresserischer Gewalt, verlieren damit den Status einer rechtmäßigen Organisation und sind entsprechend zu sanktionieren.
Gruppenrecht versus Menschenrecht
In der Berufung auf kollektive Rechte in der damaligen Gegenwart erkennt Rand einen Berührungspunkt zwischen vormodernen barbarischen Kulturgemeinschaften und der Neigung westlicher Nationalstaaten, Prinzipien bürgerlicher Vergesellschaftung in sich selbst zurückzunehmen: „Diese Lehre (der kollektiven Rechte, S.S.) basiert […] auf Mystizismus: Entweder auf dem altmodischen Mystizismus des Glaubens an übernatürliche Eingebungen wie an ‚das göttliche Recht der Könige‘ oder auf dem gesellschaftlichen Mystizismus der modernen Kollektivisten, die die Gesellschaft für einen Superorganismus halten, für eine übernatürliche Entität, die über der Summe ihrer individuellen Mitglieder steht.“ (18) Eine Ursache der Ohnmacht des westlichen Liberalismus macht sie darin aus, dass dessen Vertreter sich aus einem falsch verstandenen Internationalismus heraus weigerten, „zwischen rationalem Patriotismus und blindem, rassistischem Chauvinismus zu unterscheiden“, und nicht minder als die Linken an „die Aufhebung nationaler Grenzen und die Verschmelzung aller Nationen in ‚Eine-Welt’“ wie an eine Ersatzreligion glaubten. (19) Dadurch aber machten sich gerade Liberale und Linke, nicht konservative Republikaner, zur „Speerspitze […] des urzeitlichen Stammesrassismus“ auf der Höhe der Zeit: „Während die ‚Liberalen‘ in den zivilisierten Ländern des Westens immer noch Internationalismus und globale Selbstaufopferung propagieren, wird den wilden Stämmen Afrikas und Asiens das souveräne ‚Recht‘ gewährt, einander in Rassenkriegen abzuschlachten. Die Menschheit fällt zurück in eine präindustrielle, prähistorische Gesellschaftsform: Rassischen Kollektivismus.“ (20) In ihrem im selben Jahr erschienenen Text „Rassismus“ stellt Rand eine Verbindung her zwischen einer liberal daherkommenden Anerkennung kultureller, über Herkunft und Brauch tradierter Eigenschaften und dem nationalsozialistischen Vernichtungswahn und hält mit charakteristisch eisigem Charme fest, was deutscher Herzenswärme seit jeher für unmenschlich gilt, dass nämlich in einer zivilisierten Gesellschaft solche Eigenschaften, für die man nichts kann, weder als Makel noch als Verdienst zu gelten haben: „Die achtbare Familie, die wertlose Verwandte unterstützt oder ihre Verbrechen vertuscht (als ob die moralische Statur eines Menschen durch die Handlungen eines anderen beschädigt werden könnte) – die Eltern, die Stammbäume konsultieren, um potentielle Schwiegersöhne zu beurteilen […] – all das sind Beispiele […] für die atavistische Manifestation einer Lehre, die sich im Stammeskrieg prähistorischer Wilder, in der totalen Abschlachtung in Nazi-Deutschland und in den Gräueltaten der sogenannten ‚Schwellenländer‘ von heute ausdrückt.“ (21)
Wenn Rands Ausführungen, obwohl sie hier nicht vom Islam spricht, (22) heute wie ein Kommentar zur deutschen Islamophilie klingen, so deshalb, weil die von ihr diagnostizierte Tendenz dank Deutschland immer stärker zur inneren Bedrohung aller westlichen Staaten wird. Vom Bestreben, der kulturellen Herkunft von Menschen auch bei ihrer Einbürgerung Tribut zu zollen, über die präventive Bereitstellung von Gebetsteppichen und Koran-Ausgaben für „Geflüchtete“ bis zur Schaffung von Sonderrechten zwecks Duldung von Kinder- und Scharia-Ehen und zur Anerkennung gekränkter Ehre als Strafmilderungsgrund für Mörder und Vergewaltiger betreibt Deutschland die transnationale Durchsetzung islamischer Sonderrechte im Namen humanitärer Nothilfe. Wenn ein der Vergewaltigung angeklagter afrikanischer Flüchtling sich vor Gericht mit dem Argument verteidigt, sein Vater genieße in der Heimat die Privilegien eines Stammeshäuptlings, wird in Deutschland nicht laut gelacht, sondern bedenkenträgerisch gemurmelt; wenn ein islamischer Asylbewerber seine Frau, die er der Untreue verdächtigt, auf offener Straße hinrichtet, wird das zum Anlass genommen, die kulturelle Fremd- und Selbstwahrnehmung neu auszuhandeln; und die Umtriebe arabischer Verbrecher-Clans werden von verantwortlichen Politikern im Tonfall eines enragierten Hausvaters kommentiert, der auf den Tisch haut, weil die Söhnchen sich diesmal aber wirklich zu viel herausgenommen haben. (23) Während autochthone, westlich sozialisierte Kinder hierzulande immer stärker wie eine besonders vielversprechende Haustierspezies behandelt werden, deren Gattungsexemplare ganztags durch ständig den Eltern zur Verfügung stehende Fachkräfte auf Kreativität und Munterkeit zu trimmen seien, gelten erwachsene islamische Gewaltverbrecher, vor allem, wenn sie „geflüchtet“ sind, als Unmündige, die ihren Taten zum Trotz allein schon durch ihre putzigen Haartollen bunte Menschenfreundlichkeit bekunden.
In der Kritik an einer Rechtsauffassung, die Einzelnen wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer Gruppe Sonderrechte zugesteht und individuelle Verantwortung für begangenes Unrecht unter Verweis auf erlittene Ausgrenzungserfahrungen einklammert, war Ayn Rand durchaus Hannah Arendt nahe, deren Ansichten über die amerikanische „Rassenfrage“ und zur damaligen Frauenbewegung heute bei einschlägigen pressure groups wenig Resonanz finden. Indessen hat Arendt in ihren Ausführungen über die Aporien der Menschenrechte im Zeitalter der Nationalstaaten den Konflikt zwischen Individualrecht und Staatsbürgerschaftsrecht zum Gegenstand gemacht, den Rand mit ihrer Polarisierung von repressivem Gruppen- und fortschrittlichem Individualrecht nicht zu fassen bekommt. Zwar verweist auch Rand auf den Zusammenhang zwischen Staatsbürgerschaftsrecht und Individualrecht: „Eine Nation ist wie jede andere Gruppe nur eine Anzahl von Individuen und kann keine anderen Rechte haben als die Rechte ihrer individuellen Bürger. Eine freie Nation […] hat ein Recht auf ihre territoriale Integrität, ihre Gesellschaftsform und ihr Regierungssystem.“ (24) Doch so triftig das als Argument gegen einen entgrenzten Antinationalismus klingt, wird dabei ein funktionierendes System der Nationalstaaten, das aus dem Primat des Individual- vor jedem Gruppenrecht hergeleitet werden soll, in Wahrheit schon vorausgesetzt. Darin zeigt sich die Schwäche jedes Anarchismus, dessen rechtslibertäre Variante Rand vertritt: Das Individuum, von dem ausgegangen wird, ist in Wahrheit nicht das Erste, sondern etwas Spätes, Resultat jener Vermittlungsformen, die es ermöglichen und bedrohen. Wie das Staatsbürgerschaftsrecht die Individuen gegenüber Staaten schützen kann, die als Exekutoren von Gruppenrechten fungieren, das kann Rand nicht beantworten.
Die Krise der Staatsbürgerschaft
Arendt dagegen arbeitet den Widerspruch heraus, dass die Menschenrechte, da sie nur als individuelle Rechte Geltungskraft besitzen, ihre Realität im Zeitalter der Nationalstaaten nur als Staatsbürgerschaftsrechte haben, also im Prinzip der Volkssouveränität fundiert sind, obwohl sie ihrem Sinn nach apriorisch sein sollen: „Da die Menschenrechte als unabdingbar und unveräußerlich proklamiert wurden, so dass ihre Gültigkeit sich auf kein anderes Gesetz oder Recht berufen konnte, […] bedurfte es anscheinend auch keiner Autorität, um sie zu etablieren. Der Mensch als solcher war ihre Quelle wie ihr eigentliches Ziel. […] Wie das Volk der einzige anerkannte Souverän in allen Angelegenheiten öffentlichen Handelns geworden war, so der Mensch die einzige Autorität in allen Fragen von Recht und Unrecht. […] So schien es eigentlich fast selbstverständlich, dass diese beiden Dinge: Volkssouveränität und Menschenrechte, einander bedingten und sich gegenseitig garantierten.“ (25) Mit dem im 20. Jahrhundert im Zuge des Krise der Nationalstaaten massenhaft werdenden Phänomen der Staatenlosigkeit ist für Arendt evident geworden, dass das „Recht, Rechte zu haben“, (26) das sich in den Menschenrechten zusammenfasst, in dem Moment nicht mehr garantiert werden kann, da dessen proklamierte Träger die Staatsbürgerschaft verlieren: Gerade die Partikularität des bürgerlichen Nationalstaats, und nur sie, ist der prekäre Garant des Universalen. Da Arendt das Phänomen der Staatenlosigkeit sehr allgemein fasst und die Emigrationsgeschichte der Juden eher als Kristallisationspunkt einer transnationalen Krise von Staatsbürgerschaft überhaupt sieht, fällt es ihren Adepten, von Giorgio Agamben bis hinab zu Thomas von der Osten-Sacken, heute leicht, ihre Argumente für eine antinationale Apologetik des Flüchtlings als anthropologische Grundfigur des 20. Jahrhunderts in Dienst zu nehmen.
Eine solche Instrumentalisierung übergeht nicht nur, dass Arendt ihre Gedanken ausgehend von der heute historischen Konstellation im Übergang zwischen dem Zerfall der alten Reichsgebilde hin zu modernen Nationalstaaten entfaltet hat, sondern auch, dass die Situation der Juden für sie deshalb entscheidend war, weil die nationalsozialistische Vernichtungsdrohung brutal in den Blick rückte, was den Judenhass in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert vom Hass auf rassisch oder kulturell bestimmte Minderheiten unterschied: Spätestens mit Heinrich von Treitschke formierte sich ein Antisemitismus, der den Juden nicht nur den Weg der Assimilation zum Zweck der Anerkennung als freie und gleiche Staatsbürger, sondern auch die Möglichkeit abschnitt, sich unter Berufung auf kollektive Minderheitenrechte der Bedrohung an Leib und Leben zu erwehren. (27) Das Problem der von Rand diskutierten Gruppenrechte prallte an ihrer Situation ebenso ab, wie sie der Individualrechte qua staatsbürgerlich garantiertem Recht beraubt wurden. Die Konstitution als durch staatliche Diskriminierung zusammengehaltenes ethnisches Kollektiv, die die Geschichte der antikolonialen Befreiungsbewegungen zu einer Geschichte der Selbstrassifizierung Unterdrückter, und damit zu einer tendenziell zivilisationsfeindlichen Angelegenheit gemacht hat, war den Juden unvollziehbar – nicht nur, weil sie nicht als „Rasse“ unterdrückt, sondern als „Gegenrasse“ vernichtet werden sollten, sondern auch, weil eine solche homogene Kollektivität dem Judentum immer fremd war: Der gemeinsame Glaube, auf dem „portativen Vaterland“ (Heinrich Heine) des Buches und der unendlichen Auslegung der heiligen Schriften fußend, beruhte auf dem Vertrauen in die Möglichkeit einer Assoziation der Unverbundenen, die den Primat des Einzelnen auch gegenüber der religiösen Gemeinschaft festhielt. Die Versuche des frühen 20. Jahrhunderts, im Zuge einer Erneuerungsbewegung eine gemeinschaftsstiftende jüdische Kultur zu begründen, (28) waren ein modernes Phänomen und reagierten bereits auf die Einsicht in die Bedrohung.
Mit dem Kollektivsubjekt der „Geflüchteten“, das unausgesprochen, aber offenkundig als islamisch und nicht etwa als begründet islamfeindlich vorgestellt wird, ist im Zuge der deutschen Migrationspolitik ein potentielles Subjekt kollektiver Rechte geschaffen worden, das wie ein bösartiger Wiedergänger der von Arendt beschriebenen Staatenlosen erscheint, die, da sie keine Träger staatsbürgerlich garantierter Rechte waren, gerade kein Kollektiv, sondern eine Nicht-Gruppe Vogelfreier gewesen sind. Das Kollektivsubjekt der „Geflüchteten“ hingegen figuriert als möglicher Träger von Gruppenrechten, die, wenn sie sich nicht aus dem Staatsbürgerschaftsrecht der Nationalstaaten ableiten lassen, diesen durch eine transnationale Vereinbarung, durch einen „Migrationspakt“ eben, oktroyiert werden müssen. Möglich wird das, weil die „Geflüchteten“, selbst wenn sie Staatenlose sind (was nicht der Regelfall ist (29), mit der „islamischen Kultur“ über eine Bindungskraft verfügen, die über den Nationalstaat hinausweist, ja ihn als Organisationsform niemals akzeptieren kann – auf eben diese Bindekraft baut die deutsche Migrationspolitik, statt sich zu bemühen, sie im Namen all jener zu schwächen, die dieser Bindekraft entkommen wollen. Man suggeriert, die Weltgemeinschaft vermeide durch Schaffung neuer Rechte für Nicht-Staatsbürger die Fehler, die während des Nationalsozialismus zur Preisgabe der Juden als Staatenlose geführt hätten. Tatsächlich wird gar nicht darüber nachgedacht, wie man verhindern kann, dass die Deutschen das nationalsozialistische Versprechen, Europa judenrein zu machen, auf dem Umweg über die Duldung und Förderung des islamischen Antisemitismus am Ende doch wahrmachen. (30) Dass die Juden, nicht die Moslems, den Status des Einzelnen, und damit in gewisser Weise den Bürger par excellence vorstellen; dass antinationale Antisemitismuskritiker also ein Widerspruch in sich sind, das fällt keinem auf, weil man sich sagt, dass vom islamischen Antisemitismus bedrohte Juden ja notfalls nach Israel gehen können. (31) Aber Israel wurde nicht gegründet, damit der Rest der Welt im Judenhass versinken kann, sondern, damit Juden auf der ganzen Welt als Freie und Gleiche leben können: Das ist, nach dem Scheitern der kommunitär-sozialistischen Gründungshoffnung, seine verbliebene Utopie.
Die Avantgarde der Nicht-Staatsbürger
Die freiwilligen Selbstverpflichtungen, die der von der Bundesregierung eifrig beworbene, ansonsten vorwiegend von undemokratischen Staaten und Terrorregimen unterstützte „Migrationspakt“ kodifiziert, markieren eine fortgeschrittene Erosion des Prinzips der Staatsbürgerschaft, die den Doppelpass als tendenziell anachronistisch erscheinen lässt. Bezog die doppelte Staatsbürgerschaft ihr Renommee aus der Fiktion einer international wohlaustarierten Bilateralität, verlangt die „multipolare Weltordnung“ nach einer nationalstaatenfeindlichen Staatsräson, die eher als vom Staatsbürgerschaftsrecht durch die Ideen der „Non-Citizenship“-Bewegung inspiriert ist. Das Konzept der „Non-Citizenship“ wurde in den USA im Umfeld von Occupy diskutiert und ist vor der migrationspolitischen Wende 2015 im Kontext der „Refugee Strikes“ populär geworden. Es zielt auf eine restlose Transformation von Individual- in Gruppenrechte, indem es „Non-Citizenship“ als den Rechtsstatus all derer bestimmt, die „nicht zählen“, also den diversen, aus unterschiedlichen Gründen Marginalisierten angehören – und zwar deshalb, weil sie sich selbst so definieren. „Non-Citizenship“ zielt statt auf den Kampf um die Gewährung von Bürgerrechten (wie es noch vor einigen Jahren bei den Protesten der Sans Papiers gängig war) auf Installation kollektiver Gegenrechte gegen den bürgerlichen Staat. „Wir werden ignoriert, wir zählen nicht“, beschreibt ein „Non-Citizenship“-Aktivist in der Jungle World das verbindende Element im Selbstverständnis der sich als Nicht-Bürger bestimmenden Gruppen: „Wir können uns die Art unseres Lebens nicht aussuchen, wir zählen nicht, wir sind nicht wichtig. Das ist unsere Gemeinsamkeit und deswegen müssen wir uns verbünden.“ (32) Abgesehen davon, dass auch kein Bürger sich die Art seines Lebens aussuchen kann und es geradezu Prinzip bürgerlicher Vergesellschaftung ist, die Einzelnen im Glauben an ihre „Wichtigkeit“ zu kränken, wird in solchem Selbstverständnis das Negative – die Entmündigung der Einzelnen qua Angehörigkeit zu einer diskriminierten Gruppe –, das die Bürgerrechtsbewegungen zu überwinden antraten, zum alleinigen Konstituens des Zusammenhalts: Benachteiligt zu sein und sich damit zu identifizieren, mutiert zum einzigen Rechtsgrund, auf den man sich beruft, um geltendes Recht abzuschaffen.
Dass solche Vorstellungen einer negativen Aufhebung des Rechtsstaates nicht das Ziel haben, zu verhindern, dass europäische Juden aus ihren Nationalstaaten fliehen müssen, sondern vielmehr ein Europa ohne Juden als Bedingung migrationspolitischer Erneuerung im Grunde schon stillschweigend voraussetzen, ist offensichtlich, soll doch mit dem Prinzip der Staatsbürgerschaft, das Arendt nicht abgelehnt, sondern in seiner Widersprüchlichkeit entfaltet hat, alles kassiert werden, worauf Juden sich außerhalb Israels in Nationalstaaten berufen können. „Non-Citizens“ können nur Personen sein, die dies durch Zugehörigkeit zu dem geltend machen, was Ayn Rand „Verbrecherbande“ nennt. Wo das Rechtssystem nur noch als Mediator zwischen Gruppenrechten in Betracht kommt, ist von vornherein klar, dass sich nicht diejenige Partei durchsetzt, die im Recht ist, sondern diejenige, die das Recht qua Recht des Stärkeren suspendiert. Einen Vorgeschmack auf diese Transformation des Rechtsstaats gab im vergangenen Jahr die Münchener Start-up-Initiative „Social Bee“, (33) indem sie ganz migrationsfreundlich aussprach, was der humanitäre Jargon der Zivilgesellschaft einstweilen verschweigt. Sie plakatierte unter dem Slogan „Soft Skills Can Come the Hard Way“ eine Reihe Fotos von „Geflüchteten“ als Bewerber um einen Platz im postnationalen Kulturbiotop mit entsprechenden Selbstbeschreibungen. Zeray aus Eritrea etwa sagt: „Ich bin teamfähig. Ich habe mit 85 Menschen in einem kleinen Schlauchboot überlebt.“ Bangalie aus Sierra Leone spricht: „Ich bin zielorientiert. Auf der Flucht war ich drei Monate lang zu Fuß unterwegs.“ Der Vorwurf, hier würden traumatisierte Menschen durch Spekulation mit ihrem Leid verhöhnt, ließ nicht auf sich warten. Doch er trifft die Kampagne nicht. In Wahrheit hat sie vor Augen geführt, was die Deutschen bei ihrer Begeisterung für bereichernde Kulturen antreibt: Wer es bis hierher geschafft hat, so geht der Gedanke, der ist zu allem zu gebrauchen, ein ungeschliffener Diamant, Rohstoff in Menschengestalt sozusagen. Dass Rohheit zwar menschlich ist, sich aber eher gegen andere Menschen zu wenden pflegt, als dabei zu helfen, das Zusammenleben aller menschenfreundlicher zu gestalten, darüber wird geschwiegen, so lange es geht.
Sabine Schulzendorf (Bahamas 81 / 2019)
Anmerkungen:
- Der Historiker Dieter Gosewinkel zeigt, dass die bundesdeutsche Asylpolitik keineswegs besonders restriktiv, sondern vielmehr durch den „Kontrast“ zwischen einer „systemimmanenten Liberalität der Ausländerpolitik“ und einer „exklusive(n) Staatsangehörigkeitspolitik“ geprägt gewesen ist. Vgl. Ders.: Schutz oder Freiheit? Staatsbürgerschaft in Europa im 20. und 21. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 2016, 494 ff., hier 495.
- vgl.: https://www.bmi.bund.de/DE/themen/verfassung/staatsangehoerigkeit/optionspflicht/optionspflicht-node.html.
- siehe beispielhaft: http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/newsletter/57100/in-der-diskussion-doppelte-staatsbuergerschaft.
- hierzu Gosewinkel: a.a.O., 119 ff.
- „Die Staatsangehörigkeit verliert nicht, wer vor dem Erwerbe der ausländischen Staatsangehörigkeit auf seinen Antrag die schriftliche Genehmigung der zuständigen Behörde seines Heimatstaats zur Beibehaltung seiner Staatsangehörigkeit erhalten hat.“ (§ 25 Abs. 2 des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 23.7.1913)
- vgl. insgesamt Panikos Panayi: The Enemy in Our Midst. Germans in Britain During the First World War, New York, Oxford 1991.
- Grundlegend hierfür ist immer noch Hannah Arendt: Der Niedergang des Nationalstaates und das Ende der Menschenrechte, in: Dies.: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, totale Herrschaft, München 2001, 559–625.
- Gosewinkel: a.a.O., 273 f. In der letzten Phase des Zweiten Weltkrieges bestand die deutsche Armee zu 13 Prozent aus Ausländern. Siehe Andreas Fahrmeir: Citizenship. The Rise and Fall of a Modern Concept, New Haven, London 2007, 164.
- hierzu Gosewinkel: a.a.O., 274 ff.
- In Çilelis 2006 erschienenem Buch Wir sind eure Töchter, nicht eure Ehre klingt schon im Titel an, dass die Differenz zwischen Demos und Ethnos selbst kein bloß kultureller Unterschied, sondern einer ums Ganze ist.
- Dieses und die folgenden Zitate nach: http://www.cileli.de/2013/03/doppelte-staatsburgersch aft-qual-der-wahl/
- siehe Ulrich Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland, München 2001, 296 ff.
- vgl.: http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/Sonderverfahren/SichereHerkunftsstaaten/sichere-herkunftsstaaten-node.html.
- vgl.: https://www.gruene-bundestag.de/integration-fluechtlingspolitik/maghrebstaaten-sind-auch-2019-nicht-sicher.html. Der Widerspruch zwischen dem Konzept der „sicheren Herkunftsstaaten“ und dem immer nur individuell einklagbaren Grundrecht auf Asyl ist in dieser Erklärung bündig dargestellt.
- So die Formulierung im Koalitionsvertrag zu Flucht, Vertreibung und Migration vom März 2018: https://www.bundesregierung.de/resource/blob/656734/847984/5b8bc23590d4cb2892b31c 987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data .pdf?download=1, dort S. 108. Der Begriff der Vulnerabilität, der in der Medizin die Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten bezeichnet, befördert eine Biologisierung des Kulturellen. In islamischen „Kulturen“ sind Homosexuelle demnach „vulnerabel“, weil jene sich durch diese in ihrem Ehrverständnis gekränkt sehen, weshalb Homosexuelle möglichst in westliche Gesellschaften umgepflanzt werden sollten, ohne dass sich am islamischen Status quo dadurch irgendetwas ändert.
- Die Übertragung innenpolitischer Sicherheitsbefugnisse durch die Landkreise an Subunternehmen befördert diese Tendenz. So sind z.B. ab 2015 im Kreis Lörrach acht Flüchtlingsheime von Mitgliedern der islamistischen „Rocker“-Bande Osmanen Germania beaufsichtigt worden, die die zuständige Sicherheitsfirma ohne Wissen der Verwaltung beauftragt hatte. Vgl: https://www.welt.de/politik/deutschland/article174864925/Osmanen-bewachten-in-Suedbaden-acht-Fluechtlingsheime.html.
- Ayn Rand: Die Tugend des Egoismus. Eine neue Auffassung des Eigennutzes. Mit weiteren Beiträgen von Nathaniel Branden, Jena 2017, 132 ff., hier 134; Hervorhebung S.S.
- ebd.
- ebd., 137 f.
- ebd., 138. – Unter diesem Aspekt wäre der mit Vernunftkriterien nicht fassbare deutsche Volkskrieg gegen Dieselautos, Kohle- und Atomkraftwerke, Raucher, Alkoholtrinker und Fleischesser zu sehen: Als der Homo sapiens dazu überging, statt nur Pflanzen auch Tiere zu fressen, tat er einen bedeutenden Schritt in Richtung Menschheit, weshalb Leute, die aus eigener Entscheidung ungesund leben, das Prinzip der Zivilisation besser begriffen haben als ernährungsphysiologisch anästhesierte Veganer.
- ebd., 164 ff., hier 164 f.
- Für ihre überlieferten Äußerungen zum „arabisch-israelischen Konflikt“ sähe sich Rand inzwischen wohl nicht nur seitens von Islamisten, sondern auch von Linken mit Morddrohungen konfrontiert. Vgl. etwa: https://www.youtube.com/watch?v=2uHSv1asFvU.
- Zu den erwähnten Fällen vgl. Magnus Klaue: Der Schwarze Mann und der Mob, sowie Nicole Jesen: Die tschetschenischen Sitten und ihre Vollstrecker, in: Bahamas 77 (2017), 25 ff. und 15 ff. – Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel sagte nach der Beschlagnahmung von Immobilien einer kriminellen libanesischen Großfamilie jüngst, dies werde „große Wirkung in der arabischen Community“ haben und sei ein Signal an „die wenigen schwarzen Schafe“ dort. Vgl.: https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/offene-rechnung-der-staat-greift-nach-dem-geld-von-berlins-kriminellstem-clan/22820606.html. Die Berliner Zeitung traf den Chef des Clans in einem Berliner Hotel, um mehr über sein abwechslungsreiches Familienleben zu erfahren: „Issa Remmo hat 13 eigene Kinder. Die meisten sind schon erwachsen, ein Sohn studiert Bauwesen, die kleinste Tochter geht noch auf die Grundschule. Mindestens zwei seiner Söhne sind aber auch schon polizeibekannt. Einer der beiden, Ismail, steht gerade vor Gericht, weil er mit Komplizen einen Gläubiger seines Vaters totgeprügelt haben soll. Die Beweislage in dem Verfahren ist kompliziert.“ Vgl: https://www.berliner-zeitung.de/berlin/arabische-grossfamilien-issa-remmo---eine-berliner-karriere-31523976.
- vgl. Rand: a.a.O., 134 f.
- vgl. Arendt: a.a.O., 603
- ebd., 614
- vgl. Eleonore Sterling: Judenhass. Die Anfänge des politischen Antisemitismus in Deutschland (1815–1850), Frankfurt a. M. 1969. Zur Bedeutung Treitschkes siehe die Dokumentation: Der Berliner Antisemitismusstreit, hg. von Walter Boehlich, Frankfurt a. M. 1965.
- In diesen Zusammenhang gehört der Kulturzionismus Martin Bubers, der ebenso eine Antwort auf den deutschen Judenhass wie eine Alternative zum politischen Zionismus sein sollte.
- Dass die Staatsangehörigkeit bei vielen „Geflüchteten“ schwer zu ermitteln ist, macht sie noch nicht zu Staatenlosen. Der kollektive Entzug der Staatsbürgerschaft von Juden durch das nationalsozialistische Deutschland hat eine neue Staatenlosigkeit produziert, die mit der Situation von Kriegsflüchtlingen, deren Staat im Zerfall begriffen ist, zu vergleichen eine Relativierung der Lage jüdischer Flüchtlinge bedeutet.
- Diese Befürchtung formuliert der Politologe Danny Trom in seinem jüngsten Buch La France sans les Juifs?.
- In diesem Sinne legt Gerhard Scheit in seinem Essay „Flüchtlingsmonopoly und Israelsolidarität“ europäischen Juden nahe, sich besser gemeinsam mit antideutschen Ideologiekritikern für den israelischen Staat einzusetzen, als in dubioser Allianz mit Rechten für den Erhalt ihrer Sicherheit innerhalb der europäischen Nationalstaaten zu kämpfen: „Sub specie des Antisemitismus sind sie auf keine vergleichbare Weise von der terroristischen Gefahr wie auch alltäglicher physischer Bedrohung durch nicht unbedingt djihadistisch gesinnte Muslime betroffen“, obwohl „beides […] sich im Laufe weiterer Einwanderung verschärfen“ könnte. Vgl. Sans Phrase 8 (2016), 8. Israelsolidarität ist hier nicht mehr die Konsequenz des Eintretens für die Sache der Juden, sondern Alibi dafür, sich mit der Situation der Juden in Europa nicht genauer zu beschäftigen, als es das politische Bekenntnis erlaubt.
- vgl.: https://jungle.world/artikel/2013/09/aufstand-der-nichtbuerger.
- vgl.: http://www.employ-refugees.de/. Hieraus die folgenden Zitate.
SPALTE3-AKTUELL-RUBRIK
Frühere Aktivitäten sind im Aktuell-Archiv aufgeführt. Dort gibt es auch einige Audio-Aufnahmen.
Alle bisher erschienenen Ausgaben der Bahamas finden Sie im Heft-Archiv jeweils mit Inhaltsverzeichnis, Editorial und drei online lesbaren Artikeln.